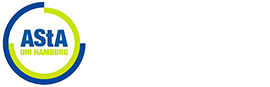Pressemitteilung: Zur Rückkehr Bernd Luckes an die Universität Hamburg oder: Die Geister, die er rief
29 July 2019

Photo: I. Mannott AStA/UHH
AfD-Mitgründer Bernd Lucke kann sich nach seiner Rückkehr an die Universität Hamburg auf lautstarke Proteste einstellen. Die kritische Studierendenschaft der Uni Hamburg wird nicht zulassen, dass der Mann, der eine Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland trägt, ohne weiteres in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm zurückkehren kann.
Karim Kuropka, Erster Vorsitzender des AStA der Universität Hamburg: „Bernd Lucke vertritt als Wirtschaftswissenschaftler ein Modell, welches einen schlanken Staat, den weiteren Abbau der Sozialsysteme und noch freiere Märkte fordert. In den letzten zehn Jahren und mit der weltweiten Finanzkrise hat sich jedoch gezeigt, dass die Ideologie freier Märkte gescheitert ist: So hat zum Beispiel der Mindestlohn in Deutschland nicht zu mehr Arbeitslosigkeit geführt und dagegen das Sparen und Zurückhalten der südeuropäischen Staaten nichts an der dortigen drastischen Jugendarbeitslosigkeit verbessert. Bernd Lucke gründete für diese Ideologie eine Partei und nahm für deren Erfolg skrupellos rechte bis rechtsextreme Positionen in Kauf. Letztendlich hat er mit dieser Toleranz und seiner bürgerlichen Fassade den Weg der AfD zur menschenverachtenden und rassistischen Partei geebnet. So ein Mensch gehört an keine Universität und speziell die Universität Hamburg kann auf seine Rückkehr getrost verzichten.“
Niklas Stephan, Referent für Antidiskriminierung des AStA der Universität Hamburg: „Lucke hat mit der AfD ein Monster geschaffen und sich anschließend feige aus der Verantwortung gezogen. Mit dem Erbe seiner Partei haben heute eine Vielzahl emanzipatorischer Institutionen zu kämpfen, dazu zählen auch die Universitäten. Insbesondere kritische Wissenschaftsansätze wie die Queer- und Gender Studies oder die Klimaforschung geraten in das Fadenkreuz der Rechten, aber auch unser Engagement als AStA wird in Form von Schriftlichen Anfragen unter Druck gesetzt. Mit derartigen Anfragen mussten wir uns in der laufenden Legislatur bereits mehrfach auseinandersetzen.“
Der AStA der Universität Hamburg zu Luckes politischer Karriere
Die Empörung war groß, als Bernd Lucke im Jahr 2013 gemeinsam mit Alexander Gauland und Frauke Petry die damals noch als „eurokritisch“ betitelte Partei „Alternative für Deutschland“ gründete – eine Partei, welche sich in politischen Gefilden rechts der Union bewegt und der zugleich Professor*innen und Jurist*innen angehören – das war lange Zeit nicht vorstellbar.
Betrachtet man die Partei heute, so erscheint Bernd Lucke im Rückblick fast ein wenig wie der Saubermann, der sich kaum etwas vorzuwerfen hat: Noch während seiner Zeit an der Parteispitze drohte der 56-jährige Ökonom Mitgliedern, welche mit Nazi-Hooligans sympathisierten, mit dem Parteiausschluss. Diese Auseinandersetzungen, insbesondere gegen den erstarkenden „Flügel“ und die sogenannte „Erfurter Resolution“ rund um den Thüringer Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, gingen schließlich mit der Wahl Frauke Petrys an die Spitze der Partei im Jahr 2015 verloren. Als letzte Konsequenz verließ Bernd Lucke die AfD. Er wolle nicht mehr als das bürgerliche Aushängeschild einer Partei herhalten, welche sich auf klarem Kurs nach Rechtsaußen befindet. Des Weiteren hat sich Lucke sogar für die Beobachtung der Partei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ausgesprochen, nachdem dieses die AfD Anfang 2019 zum „Prüffall“ erklärte.
Die AfD und ihr Verhältnis zur extremen Rechten
Luckes Parteiaustritt wird deshalb häufig als der Dammbruch nach ganz Rechts betrachtet, jedoch wurden bereits 2015 sozialwissenschaftlich drei Flügel innerhalb der Partei unterschieden: ein wirtschaftsliberaler, ein national-konservativer und ein rechtspopulistischer. Eine klare Trennung dieser war aber damals schon kaum möglich, denn die einzelnen Flügel bedienten sich – je nach Bedarf – gegenseitig. Der wirtschaftsliberale Flügel hatte mit Lucke, dem Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, einen prägnanten Kopf in der Hansestadt. Jedoch zeichnete sich schon zu dieser Zeit auch ein rechtspopulistischer Flügel im Hamburger Landesverband ab, dessen Mitglieder aus der antimuslimischen Partei „Die Freiheit (DF) (Jens Eckleben, Claus Döring) sowie der Schill-Partei „Rechtsstaatliche Offensive“ (Dirk Nockemann) in die AfD emigrierten. National-Konservative Positionen wurden vor allem dann geäußert, wenn es die Partei in Hamburg nach außen zu vertreten galt. Wurde auf Bundesebene die angebliche Kompetenz der „Professor*innenpartei“ in Fragen der Wirtschaftspolitik betont, so wurde vor Ort gerne das konservativ-hanseatische Element der Partei hervorgekehrt.
Auch wenn die intellektuelle Parteiriege rund um die Professoren Dr. Bernd Lucke und Dr. Jörn Kruse, der zu dieser Zeit noch Landeschef in Hamburg war, stets beteuerte, dass in der Partei kein Platz für extrem rechte Positionen sei, erhielten ehemalige Mitglieder derart charakterisierter Zusammenhänge schon früh Zugang zur AfD: Neben Eckleben. Döring und Nockemann konnten auch die „HogeSa“- und „PEGIDA“-Sympathisantin Tatjana Festerling sowie die beiden ehemaligen NPD-Funktionäre Björn Neumann und Thorsten Uhrhammer zumindest zeitweise Mitglied im Hamburger AfD-Landesverband werden. Die beiden letzteren waren bereits zuvor einschlägig bekannt geworden, sowohl in der rechtspopulistischen Szene als auch durch die Medien und im Falle von Neumann sogar durch namentliche Erwähnung im Hamburger Verfassungsschutzbericht. Ein Klick bei Google oder, im Falle Neumanns, ein Blick in den Geheimdienstbericht hätte gereicht, um zu wissen, wer da an die Tür der AfD klopfte.
Kritik an Luckes Rückkehr an die Universität Hamburg
Diese Tatsachenlage lässt nun mehrere Schlüsse zu: Man mag Herrn Lucke vielleicht sogar Glauben schenken, wenn dieser sagt, dass er selbst kein Rassist sei. Größere Anstrengungen gegen die Entwicklung solcher Ressentiments innerhalb seiner Partei hat der Wirtschaftswissenschaftler allerdings nicht betrieben, und dafür gibt es nur eine mögliche Erklärung: Er wollte es auch nicht. Entweder aus Angst, extrem rechte Mitglieder und Wähler*innen verprellen zu können oder weil man eine innerparteiliche Schlammschlacht vermeiden wollte. Gewissermaßen muss man ihm auch unterstellen, mit einer Wählerschaft aus den dunkelbraunsten Milieus der deutschen Politik gerechnet zu haben, welche ihm wiederum zum politischen Aufstieg verhalfen.
Medienkontakt für Rückfragen:
Inga Mannott
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
inga.mannott@asta.uni-hamburg.de