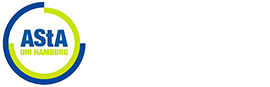Start der Reihe Schnöde neue Welt - morgen ab 18:00 Uhr in der T-Stube
23 October 2019, by Silas Mederer

Photo: AStA/L. Schneider
Die Welt ist immer noch schnöde. Deswegen muss die Veranstaltungsreihe, die ihre Schnödnis kartographiert, auch dieses Jahr wieder stattfinden. Schnöde neue Welt ist deine Chance, Grundbegriffe linker Gesellschaftskritik kennen zu lernen. Schnöde neue Welt schrubbt den Glanz von der Scheiße. Schnöde neue Welt ist für dich da, wenn du noch gar keine Ahnung hast, enttäuscht dich aber auch nicht, wenn du die Dialektik der Aufklärung als Kopfkissen verwendest. Schnöde neue Welt ist eine Trash-Party ohne Ironie. Erscheint zahlreich.
Hier sind die einzlenen Veranstaltungen, die das über das Wintersemester stattfinden werden.
24.10 - Platz machen. Feminismus in (post-)migrantischen Kontexten.
Simone Borgstede
'Woher kommst du?' werden heutzutage viele gefragt, die vermeintlich 'anders' aussehen. Als ob es einen unmittelbaren Zusammenhang gäbe zwischen Aussehen und geografischer Herkunft. Als ob zu wissen, wo eine Person geboren ist, sagt, wer sie ist.
Schon Hannah Arendt notierte in ihrem 1942 veröffentlichten Aufsatz 'We refugees', dass niemand der damals aus Nazi-Deutschland geflohenen Juden als Flüchtling angesprochen werden wollte. Es ging um das Ankommen, das durch diese homogenisierende Kategorisierung erschwert wird.
Heute werden im öffentlichen Diskurs um Flucht und Migration diejenigen, die aus Hunger und Perspektivlosigkeit fliehen, als 'Wirtschaftsflüchtlinge' adressiert, es wird von Einwanderung in 'unsere' Sozialsysteme gesprochen als ob es ein Verbrechen sei, ein gutes Leben führen zu wollen. Niemand fragt nach dem Privileg, in einem Land mit kostenlosem Bildungssystem, dem Recht auf ein Existenzminimum und Gesundheitsversorgung geboren worden zu sein.
Wir nutzen feministische postkoloniale Theorie und Praxis zur kritischen Reflexion/ zum Aufbrechen hegemonialer Vorstellungen vom ‚wir’ und ‚den Anderen’. Wir setzen uns damit auseinander wie Macht und Identität(en) zusammenhängen, was Zuschreibungen anrichten und wie wichtig Selbst-Repräsentation ist. Wir eruieren, wie wir durch Kritik „Räume schaffen, in denen die Anderen gehört werden“ (Varela/Dhawan 2012, 279).
14.11 - Antiökologie – ein spätkapitalistisches Syndrom
Felix Riedel - Felix Riedel (Dr. phil.) ist promovierter Ethnologe und freiberuflich in der politischen Bildung tätig. Er führt das Blog www.nichtidentisches.de und publiziert als freier Autor (www.felixriedel.net).
Die kapitalistische Produktionsweise basiert auf zwei Quellen: die Ausbeutung der Arbeiter und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. In einem zum Wachstum verdammten System muss daher eine von beiden Quellen stärker ausgebeutet werden, wenn die der anderen Quelle Schranken erfährt. Der Fortschritt des Wohlstandes der Arbeiterschaft in den Industriestaaten basierte auf der beispiellosen Ausbeutung von natürlichen Ressourcen: Walfang, Holzkohle, später Braun- und Steinkohle, Reduktion von Fischbeständen, Urwäldern und letztlich Zerstörung der klimatischen Stabilität.
Unter dem Druck von ArbeiterInnen wurden Teile der Umweltbelastung technologisch gelöst, indem Filter und Verbrennungstechnik die Arbeits- und Lebensbedingungen im Westen wieder angenehmer machten. Das weckte die Suggestion einer ewigen technologischen Lösbarkeit. Tatsächlich aber wurde der Raubbau kaschiert und verlagert. Einen globalen Rückgang der Belastung von Natur gab es nie. Der „London peasoup fog“ ereilte nunmehr Peking, statt Walfett werden Torfwälder in Indonesien verbrannt. Und trotz aller Filtertechnik gelingt es nicht, den globalen CO2-Ausstoß zu senken. Eine Verdoppelung von Weltwirtschaftsleistung bei gleichzeitiger Halbierung oder sogar Nullierung des CO2-Ausstoßes ist schlicht unmöglich.
Mehr denn je ist die Umstellung auf Planwirtschaft gefragt und weniger denn je ist sie erwartbar. Die anstehende Katastrophe weckt das Bedürfnis nach bürgerlicher Ideologie: Leugnung, Schuldprojektion und Fatalismus sollen verdrängen, was an rationalen Antworten entsteht in den Klimastreiks von Kindern, in den vermeintlich hilflosen Rebellionen, in den privaten Lösungen.
Rackets aus Lobbyisten, Rechtspopulisten und Agitatoren übertreffen sich in der Ausbeutung intellektueller Ressourcen für diesen ideologischen Krieg, der letztlich die Besitzstandswahrung bis zuletzt aufrechterhalten soll. Die Fälschungen haben vor allem die Funktion des Astroturfing: künstliche Suggestionen von breiter Anhängerschaft und dadurch gesellschaftlicher Relevanz. Erstes Ziel der Antiökologie ist der Angriff auf klar erkennbare Gruppen, die das Prinzip der Ökologie vertreten: Die Grünen wurden von CDU/CSU, AFD und FDP als Hauptgegner gewählt und mit Propaganda überzogen, die häufig auf nationalsozialistische Bilder und Motive zurückgreift.
Tatsächlich ist Wissenschaft trotz lobbygesteuerter Gegenstudien einhelliger denn je, was die zentralen Probleme angeht: Artensterben, CO2-Gehalt, Folgenkalkulationen. Ist es unmöglich, die Katastrophe zu verhindern, die längst als Artensterben stattfindet, so steigt doch der Druck, in den kommenden zwanzig Jahren das Schlimmste im Jahr 2100 zu verhindern, also irgend unter drei Grad zu bleiben, und wenn das fehlschlägt, wenigstens die vier und die fünf nicht zu erreichen.
Der Vortrag erläutert an Beispielen die Strategien bürgerlicher Ideologien über Ökologie und Klimawandel und verweist auf die autoritären Konsequenzen, die bürgerliche Gesellschaft daraus zieht.
21.11 - System Change not Climate Change
Ende Gelände
Der Kapitalismus ist in unserer Gesellschaft allgegenwertig. Er ist so präsent, dass wir es kaum noch bemerken und ihn als selbstverständlich wahrnehmen. Genauso verhält es sich mit den Folgen des Kapitalismus. Sie betreffen uns als Menschen und die Umwelt. Dabei rückt der Klimawandel immer weiter ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber wie hängen der Klimawandel und Kapitalismus zusammen? Begünstigt der Kapitalismus den Klimawandel? Können die Klimaziele im bestehenden Wirtschaftssystem erreicht werden? Was für Alternativen gibt es?
Du bist an den genannten Fragen interessiert oder du möchtest einfach mal eine neue Perspektive kennen lernen? Dann bist du bei diesem Vortrag mit anschließender Diskussion genau richtig.
28.11 - Die Wohnungsfrage und Gentrification
Gruppen gegen Kapital und Nation
Das Stichwort „Gentrification“ beschreibt eine Stadtentwicklung, in der im Zusammenspiel von Staat, Kapital und Bevölkerungsbewegungen, arme Menschen nachhaltig verdrängt und dem linken Milieu Experimentierfelder genommen werden. Proteste dagegen gibt es nicht nur in Hamburg. Seit einiger Zeit explodieren in manchen Städten die Mieten derart, dass sogar die Politik mit Mietpreisbremse und in Berlin mit einem Mietendeckel deutlicher gegensteuern will.
Auf der Veranstaltung soll ein Erklärungsangebot für solche Entwicklungen zur Diskussion gestellt werden.
Im ersten Teil soll es grundsätzlicher um die Ökonomie von Grund, Boden und Mieten gehen. Was ist die ökonomische Logik der profitorientierten Wohnraumwirtschaft? Welche Besonderheiten gibt es in Zeiten einer anhaltenden Finanzkrise (Stichwort „Betongold“)? Warum wird bei der Suche nach Lösungen für „bezahlbaren Wohnraum“ immer nur die Mietentwicklung diskutiert, nicht aber die Lohnentwicklung?
Im zweiten Teil geht es um die Rolle der Politik bei dieser Sache. Warum hat die Politik nennenswerte Bestände von öffentlichen Wohnraum privatisiert und damit den Aufstieg der Immobilien-Konzerne in Deutschland gefördert? Warum steigen aber auch bei den städtischen Wohnungsunternehmen in aller Regel die Mieten? Und warum reden alle von „Mieterschutz“, wenn mit den bestehenden Mietrechtsregeln massenhaft Leute ihre Wohnung nicht halten können?
Auf der Veranstaltung sollen diese Fragen beantwortet und diskutiert werden. Die angebotenen Erklärungen unterscheiden sich dabei von denjenigen der kritischen Stadtsoziologie oder der Bewegung „Recht auf Stadt“. Darauf kann in Exkursen eingegangen werden, wenn man den neuesten Versuch einer Enteignung und Vergesellschaftung von Immobilien-Konzerne in Berlin mitdiskutiert.
05.12 - Zum Ende der DDR
Daniel Kulla
30 Jahre nach dem Anfang vom Ende der DDR ist sie seltsam abwesend und allgegenwärtig. Während von vielen Ereignissen nur noch stark gefärbte Erzählungen geblieben und ein Großteil schlicht verschwunden ist, springt sie sofort ins Bild, wenn’s um heutige Missstände geht oder Allgemeinurteile über den Sozialismus getroffen werden. Aber was war eigentlich sozialistisch an der DDR und warum? Und welchen Anteil hatte ihre Bevölkerung an ihrem Geschick, welche Rolle spielten internationale Konstellationen und vor allem die BRD?
Wie in seinen anderen geschichtlichen Beiträgen will Kulla zunächst zeitliche Abläufe rekonstruieren, Verbindungen herstellen und dazu einige der wirkungsmächtigsten Legenden aufbrechen. Von da aus soll es um die Frage gehen, was genau wie über die DDR hinaus nachgewirkt hat und woran heute sinnvoll angeknüpft werden kann.
09.01 - Zum Kulturbegriff der Neuen Rechten
Carina Book
Referentin Carina Book fokussiert sich bei diesem Vortrag auf den Kulturbegriff der Neuen Rechten und analysiert dessen Konsequenzen. Theater und andere Kultureinrichtungen werden zu Zielscheiben der extremen Rechten, deren Eskalationsstrategie darauf abzielt, die gesellschaftliche Dialogfähigkeit zu zerstören. Carina Book ist Politikwissenschaftlerin aus Hamburg. Sie forscht und publiziert zur Neuen Rechten. Sie sagt, sich gegenseitig weiterzubilden, in Diskussion zu kommen und gemeinsam aktiv zu werden sei das, was die Rechten am meisten zu fürchten hätten.
23.01 - Lesung aus dem Lexikon der Leistungsgesellschaft
Sebastian Friedrich
Der Streifzug durch alltägliche Begriffe der »Leistungsgesellschaft« erkundet die vorherrschende Ideologie des flexiblen Kapitalismus: den Neoliberalismus. Er ist weit mehr als ein wirtschafts- und sozialpolitischer Ansatz. Die neoliberale Ideologie prägt unsere Persönlichkeit, unser Denken, unser Handeln. Während wir Sport treiben, wir über unseren Arbeitgeber sprechen, als sei er unser bester Freund, wir in Dating-Portalen nach der Liebe fürs Leben oder dem schnellen Sex suchen, wir unser 70er Jahre-Rennrad das Altbau-Treppenhaus hochtragen, wir herzhaft über die Prolls in der Eckkneipe lachen, wir uns über unsere aktuellen Prokrastinationserfahrungen austauschen, wir mit einem coffee to go bewaffnet im Stechschritt durch die Stadt marschieren, wir lustige ironisch-geistreiche Anmerkungen machen, wir uns wieder nicht entscheiden können und wir am Ende des Tages einmal mehr versucht haben, das zu verdrängen, was längst Gewissheit geworden ist: dass es so nicht weitergehen kann.
30.01 - „YOU ARE SO AGRESSIVE!..“ ÜBER DIE UNKRITISCHE HALTUNG GEGENÜBER RASSISTISCHER UND KOLONIALER GEWALT IM AKADEMISCHEN KONTEXT
Tania Mancheno
Die bewegte Biographie Fanons erlaubt uns die immer noch aktuellen Wirkungen des Kolonialismus aus einer transkontinentalen Perspektive zu rekonstruieren. Sein politisches Denken bietet eine Definition von Gewalt an, welche die Geschichte der Versklavung als zentrale Komponente des modernen und eurozentrischen Nationalstaates erklärt. Dadurch formuliert Fanon ein viel umfassenderes politisches Denken über Gewalt sowie über die Geschichte der Gewalt als beispielsweise Max Weber, Hannah Arendt und Michel Foucault es tun. Doch seine Schriften finden kaum Platz in der Wissenschaft. Warum ist das so?
In dem Vortrag werden einige der Selbstverständlichkeiten in der Politikwissenschaft in Frage gestellt, um zusammen mit den Studierenden die Frage des 'Wer hat die Macht Gewalt auszuüben?' aus einer dekolonialen Perspektive erneut zu stellen.
Tba - Das Konzept Antifa: Entstehung, Kritik, Zukunft
NIKA Hamburg
Antifa ist eines der zentralen linken Politikfelder der letzten 20 Jahre. Und obwohl fast alle schon einmal von »der Antifa« gehört haben, ist oft nicht ganz klar, welches politische Konzept sich eigentlich dahinter verbirgt. Auch, weil im Jahr 2019 die Auseinandersetzung mit dem allgegenwärtigen Rechtsruck erneut auf der Tagesordnung stehen wird, wollen wir in einem Vortrag die Geschichte der autonomen Antifa rekapitulieren und zur Diskussion stellen.
Welche theoretischen und strategischen Annahmen standen hinter der Entstehung von Antifagruppen in den Neunzigerjahren? Wie lässt sich das offensive Vorgehen gegen Nazis mit Kapitalismuskritik verknüpfen? Ist Antifa notwendiger Abwehrkampf, strategischer Ansatzpunkt zur Weltrevolution oder am Ende gar pure Affirmation der bürgerlich-kapitalistischen Herrschaft?
Tba - Die Misere hat System – Kritik des Kapitalismus
Gruppen gegen Kapital und Nation