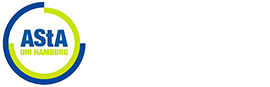Stellungnahme zu den Haushaltsverhandlungen 2021/22 und zum Hochschuletat
4 February 2021, by Karim Kuropka

Photo: Photo by Annie Spratt on Unsplash
In den vergangenen Monaten verhandelten die Hochschulen mit der Wissenschaftsbehörde (BWFGB) über die neue Hochschulvereinbarung, die den Hochschuletat für die kommenden 6 Jahre festlegen soll. Durch die Corona-Pandemie und die hierdurch reduzierten Steuereinnahmen begründet, sollen in den nächsten Jahren massive Kürzungen vorgenommen werden, die die langfristige Zukunftsplanung der Hochschulen untergraben und sie unmittelbar zum Struktur- und Personalabbau zwingen werden.
Sparen an den Universitäten hat mittlerweile Tradition
Das Sparen an der Wissenschaft ist in Hamburg inzwischen Tradition geworden und kann damit nicht allein der aktuellen Situation zugeschrieben werden: der Etat der Universität Hamburg wurde seit 2012 zwar jährlich um 0,88% gesteigert. Jedoch lagen diese Anpassungen weit unter der Inflationsrate von 1,2% und bezogen ebenso wenig die Tarifsteigerungen von bis zu 3,2% mit ein. So hat sich in den vergangenen Jahren ein erhebliches strukturelles Defizit (sog. Kostenschere) aufgebaut. Um diesen Kostenschereneffekt auszugleichen, musste die Universität über diese Zeit ihre Rücklagen weitgehend aufbrauchen und ist dadurch nun nicht mehr in der Lage, die kommenden Defizite abzufangen.
Unterfinanzierung beeinträchtigt die Lehre
Damit jedoch noch nicht genug: Obwohl die finanzielle Grundausstattung seitens BWFGB und Finanzbehörde weiter reduziert wird, werden die Hamburger Hochschulen mit weitergehenden Aufgaben betraut: So fordert die BWFGB trotz der desolaten Haushaltslage die Schaffung von eintausend zusätzlichen Studienanfängerplätzen, ohne dass hierfür entsprechende Mittel bereitgestellt würden. Logische Konsequenz ist ein geringerer Betreuungsschlüssel und damit eine weitere Qualitätsminderung in der Lehre. Bereits in der Pandemie hat sich gezeigt, dass aktuell dringend benötigte Beratungs- und Lehrkapazitäten nicht mehr allen Studierenden vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden konnten. Besonders stark trifft die Unterfinanzierung Studiengänge mit hohem Praxisanteil, die oft einer umfänglichen personellen und materiellen Ausstattung bedürfen. Um gleichzeitig die geforderten Studienzahlen einzuhalten, werden Plätze in den sog. Buchwissenschaften geschaffen, jedoch zeichnet sich auch dort bereits ab, dass die Lehrkapazitäten nicht angemessen erhöht werden. Bereits jetzt sind in nahezu allen Studiengängen verpflichtende Studieneinheiten oft hoffnungslos überbucht, Seminare mit bis zu 40 Personen in größeren Studiengängen vielfach die Regel.
Obwohl sich die Studierendenanzahl in den letzten 35 Jahren mit etwas mehr als 40.000 Studierenden nicht verändert hat, wurden von den 911 Professuren, die es im Jahr 1986 noch gab, bis heute 250 Stellen (>25%) abgebaut. Etliche Fächer und Fachbereiche mussten dadurch vollständig gestrichen werden. Aber auch in den weiter bestehenden Fachbereichen und Fakultäten wurden empfindliche personelle Einschnitte vorgenommen, auch oder gerade, wenn diese seither expandierten. Benötigte personelle und materielle Ressourcen für die Umsetzung und Planung dringend notwendiger Reformen, z.B. im Kontext der Reform der Lehrerbildung oder der Neustrukturierung des Psychologiestudiums, werden nicht bereitgestellt, auch entgegen eigener politischer Planungsvorgaben.
Geldmangel sorgt für schlechte Arbeitsbedingungen
Weniger Geld für die Universität bedeutet ebenso schlechtere Arbeitsbedingungen und sinkende Qualität der Lehre und Forschung. Die jetzt schon prekäre Lage des Universitätspersonals wird weiter verschärft und vielen Akademiker*innen droht der Verlust ihrer Existenzgrundlage. Die anhaltende Unterfinanzierung zwingt die Fakultäten dazu, bestehende Stellen nicht zu verlängern und in Zukunft weniger (unbefristete) Stellen auszuschreiben. Dies ist insbesondere für Doktorand*innen ein Problem, die meistens in Teilzeitstellen (i.d.R. 50%) arbeiten und oft nur für einen Bruchteil ihrer tatsächlichen Lehr- und Forschungstätigkeit entlohnt werden. Während grade diese prekär beschäftigte Statusgruppe mit hohem Engagement und Einsatz und oft unter Zurückstellung eigener Forschungs- und Qualifikationstätigkeiten den Lehrbetrieb im letzten Pandemiejahr ermöglichte, besteht für sie weiterhin kein Rechtanspruch auf eine pandemiebedingte Weiterbeschäftigung über bestehende Zeitverträge hinaus. Anders als Professor*innen genießt sie keinen weitreichenden Kündigungsschutz, sondern ist neben dem Technischen- und Verwaltungspersonal die einzige Statusgruppe überhaupt, in der weitreichende Kündigungen nicht mehr nur wahrscheinlich sind. Die Nachwuchswissenschaftler*innen sind von der aktuellen Pandemie also mitunter doppelt getroffen: Einerseits konnten sie ihrer Promotions- oder Habilitationstätigkeit nur eingeschränkt nachgehen, andererseits stellen sie jene Beschäftigtengruppe dar, die zuallererst von Kürzungen im Hochschuletat unmittelbar und existenziell bedroht sein wird. Langfristig werden unter diesen Bedingungen Qualifikationsstellen und Professuren mehr und mehr zu reinen Lehrstellen umgewandelt werden müssen, was Forschung und Lehre noch weiter entkoppelt – mit empfindlichen Konsequenzen für Lehrende, Forschende und Studierende gleichermaßen.
Exzellenzstatus und Forschungsprojekte leiden
Schon vor der Pandemie sind Anstellungen an Universitäten finanziell oft wesentlich unattraktiver als in der Privatwirtschaft gewesen und schon jetzt ziehen hochqualifizierte und engagierte Wissenschaftler*innen aufgrund der knappen Ausstattung andere Forschungsstandorte der Universität Hamburg vor. Ihren selbst gewählten Rollen als „Flagship University“ bzw. Exzellenzuniversität wird sie so nicht gerecht und der Exzellenzstatus wird unter diesen Bedingungen erwartbar nicht zu halten sein können. Stattdessen riskiert die Stadt einen Abwärtstrend, der nur mit enormem Aufwand wieder aufzuhalten sein wird: Drittmittel, die ein zentraler Teil der Finanzierung der Universität geworden sind, werden schlechter zu akquirieren sein, was wiederum eine weitere Reduzierung der Stellen nach sich zieht. Der Erhalt spannender zukunftsgerichteter Projekte wie beispielsweise des Universitätskollegs oder des universitätsübergreifenden Informatikprogramms ahoi.digital ist nicht möglich oder steht auf der Kippe; jahrelange Arbeit wird vernichtet. Es ist unklar, ob so aktuell dringend nötige Forschungsbereiche wie die Klimaforschung ihr Niveau halten können, wenn die Exzellenzförderung irgendwann wegbricht.
Unterfinanzierung des Studierendenwerks sorgt für weitere Belastung der Studierenden
Zuletzt darf auch das Studierendenwerk Hamburg nicht unerwähnt bleiben: Dieses erhält deutschlandweit mit die niedrigsten öffentlichen Zuschüsse, obwohl es für die Versorgung der Studierenden z.B. mit bezahlbaren Wohnungen oder preiswertem Essen am Campus unabdingbar ist. Es muss von städtischer Hand sichergestellt werden, dass es diese Aufgabe auch weiterhin wahrnehmen kann, damit keine Umlage der Kosten auf die Essenspreise oder gar die Semesterbeiträge stattfindet. Dadurch würden nämlich ein weiteres Mal die Studierenden belastet, also gerade die Personengruppe, in der in einer Stadt wie Hamburg sowieso viele Menschen Mühe haben, ihren Unterhalt zu bestreiten, und die unter den Auswirkungen von Corona mangels rechtzeitigen Handelns des BMBF besonders zu leiden hatte.
Man muss es leider deutlich sagen: Die aktuelle Finanzpolitik des Senats bezüglich der Hamburger Hochschulen steht dem Bild von offenen und inklusiven Universitäten entgegen, die für eine ganzheitliche und kritische Bildung eintreten. Es sollte einer sozialdemokratischen und grünen Regierungsverantwortung außerdem grundsätzlich widersprechen, dass Hunderte ihre Anstellung verlieren werden und wegweisende Forschung ausgebremst wird. Wir fordern den Senat auf, sich von der unverantwortlichen Sparpolitik zu lösen, den Hochschulen die nötigen Mittel zu gewähren und somit bleibende Schäden an den Hochschulen und dem Studierendenwerk zu verhindern!
Ansprechpartner für Pressefragen:
Karim Kuropka
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit AStA Uni Hamburg
karim.kuropka"AT"asta.uni-hamburg.de