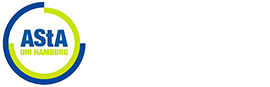Zum Klimaschutzbericht der Uni HamburgReferat zur Bewältigung der Klimakrise, AStA UHH
10 December 2023
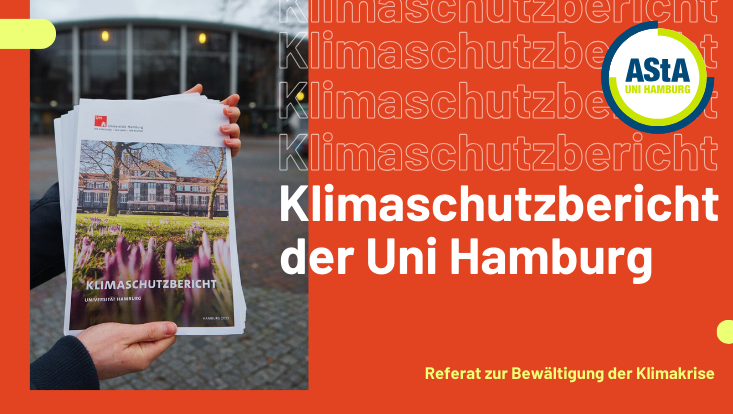
Photo: AStA/Daha Yeo/Maximilian Arndt
Die Universität Hamburg hat (wieder) einen Klimaschutzbericht! Nach vier Jahren Pause, in denen die Nachhaltigkeitsberichterstattung komplett eingestellt wurde, gibt es endlich einen neuen Bericht, der die Treibhausgasbilanzierung der Jahre 2019-21, eine Zielsetzung für Klimaneutralität und ein paar Klimaschutzmaßnahmen beinhaltet. Das ist auch unserem steten Druck, unseren Forderungen, Aktionen und Versammlungen zu verdanken!
Gerade bei der Bilanzierung der Treibhausgasemissionen setzt der Bericht neue Maßstäbe. Das ist vor allem der unermüdlichen Arbeit des Sustainability Offices und der Klimaschutzmanagerin zu verdanken, inklusive der vielen studentischen Angestellten. Danke für eure Arbeit!
Es ist wichtig, dass das Thema Klimaschutz wieder einen größeren Platz an der Universität einnimmt. Verschiedene Stellen wie das Sustainability Office werden geschaffen, Aktionen wie das offene Plenum veranstaltet und die Treibhausgasbilanzierung, wie im Klimaschutzbericht, wieder aufgenommen. Das Sustainability Office hat angefangen, einen offenen Raum zu schaffen, in dem Studierende mitarbeiten und Kritik üben können.
Gleichzeitig blicken wir als AStA auch kritisch auf den Bericht, denn trotz aller Bemühungen reicht es immer noch nicht. Das Sustainability Office ist überlastet, wie die Verzögerung des Klimaschutzberichts (um ein halbes Jahr!) zeigt. Es bedarf hier dringend weiteren personellen und finanziellen Ressourcen um den Aufgaben in angemessener Weise gerecht zu werden. Wenn die Uni ihre Klimaziele einhalten soll, muss die Stadt mehr Geld freigeben für solche Stellen - und zwar langfristig. Wir müssen raus aus der Exzellenz-Logik, die uns in Zyklen des Wettbewerbs denken lässt. Klimaschutz ist Dauer- und Zukunftsthema, unabhängig davon, ob es gerade in den nächsten Exzellenzplan passt oder nicht. Statt Klimaschutz aus Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen zu machen, wird Nachhaltigkeit an Universitäten zu oft zum Prestigeprojekt und Wettkampfvorteil für sinnlose Rankings und Ratings.
Klimaschutzmaßnahmen
Dass der Klimaschutzbericht das Ergebnis aus Zeit- und finanziellem Druck ist, merkt man ihm am meisten im letzten Kapitel an - den Klimaschutzmaßnahmen. Zur Generalsanierung von Gebäuden gibt der Bericht gerade eine viertel Seite her, zu Photovoltaik sechs Zeilen. Wo sind die Solarkarten, Potenzialanalysen und Pilotprojekte?
Es ist folgerichtig und ehrlich, das Papier einen Klimaschutzbericht zu nennen, auch wenn es als Konzept angekündigt wurde. Denn die Klimaschutzmaßnahmen schaffen es noch nicht, die Breite der Treibhausgasemissionen abzudecken. Die Systematik zur Priorisierung der Maßnahmen befindet sich noch am Anfang und kann bisher nicht mit Präzision beeindrucken. Spätestens bei der Finanzierung von Maßnahmen bleiben die Antworten vage - eben kein Konzept, sondern erst nur ein Bericht.
Fragen stellen sich uns auch bei der Festlegung von Zieljahren zur Klimaneutralität und Emissionbudgets. Im Bericht wird zwar von Klimaneutralität gesprochen, doch die Pfade zur Erreichung konzentrieren sich ausschließlich auf Treibhausgasemissionen. Dabei umfasst für uns “Klimaneutralität” mehr als das, zum Beispiel soziale Aspekte. Wir vermissen im Klimaschutzbericht eine klare Aussage dazu, dass Studierende in keiner Weise durch Maßnahmen zum Klimaschutz finanziell belastet werden.
Der nächste Bericht - das erste Konzept
Der Klimaschutzbericht darf keine einmalige Sache bleiben. Aus dem Bericht muss nächstes Jahr ein Konzept werden, die Arbeit beginnt gerade erst. Denn an vielen Stellen sind die Formulierungen schwammig und einige Themen werden komplett ausgeklammert.
Zum einen wünschen wir uns eine Offenlegung der Finanzen, die im Zusammenhang mit Klimaschutz stehen. In welche Unternehmen und Organisationen wird investiert? Wo und wie fließen Spendengelder? Inwiefern stehen Drittmittel im Konflikt mit dem Klimaschutz?
Außerdem muss die Festlegung von Zielen verbessert werden. Anstatt schlicht ein Zieljahr für Treibhausgasneutralität zu definieren und eine gerade Linie bis dahin einzuzeichnen, braucht es ein für die Universität angepasstes CO2-Budget und daran gebundene klare Maßnahmen, deren erwartete Emissionsreduktionen und zeitliche Festlegung den Pfad angeben. Und was passiert eigentlich, wenn das Ziel nicht eingehalten wird?
Als am Anfang dieses Jahres beim ersten offenen Plenum der Klimaschutzbericht angekündigt wurde, war auch von einem Kulturwandel die Rede, der neben den materiellen Maßnahmen und Veränderungen die Entwicklung der Mitarbeit und Denkweise innerhalb der Universität voranbringen sollte. Doch während das Sustainability Office selbst eine gleichberechtigte Mitarbeit von Studierenden und Mitarbeitenden auf allen Ebenen ermöglicht, ist das darüber hinaus nicht immer einfach zu finden. Wie schnell an der Uni geantwortet wird, welche Formate gewählt werden und wie der Umgang ist, darf nicht damit zusammenhängen, mit welcher E-Mail-Adresse man schreibt, mit welcher Nummer man anruft oder welchen Posten man besetzt.
Wichtige Entscheidungen, wie die Festlegung des universitären Klimaneutralität-Zieles, wurden nicht zusammen mit der der Gesamtheit der Universität, ja nicht einmal mit demokratisch-gewählten Gremien wie dem Akademischen Senat getroffen, sondern in den Sitzungen des Präsidiums ausgemacht. Wenn wir wollen, dass alle Beteiligten die Klimaschutzmaßnahmen nicht nur akzeptieren, sondern sich für sie einsetzen und daran mitarbeiten, müssen wir auch alle mitentscheiden lassen. Lasst uns Hierarchien abbauen und eine tiefgreifende Demokratisierung der Universität in die Wege leiten!
Zum Kulturwandel gehört außerdem, dass die Klimakrise und die damit einhergehende Ungerechtigkeit in ihrer Dringlichkeit und ihrem Elend benannt werden. Im Bereich der Nachhaltigkeit muss die Uni in einen Modus der gesunden Krisenkommunikation umschalten. Schluss mit Buzzwords, Strategiepapieren und Innovations-Sprech. Das wird der Notwendigkeit von Klimagerechtigkeit für die Betroffenen jetzt und unserer gesamten Zivilisation in der Zukunft nicht ansatzweise gerecht.
Klimaschutz hört nicht bei der Uni auf
Auch abseits des universitären Einflussbereichs möchten wir auf strukturelle Problematiken aufmerksam machen, die in Verbindung mit dem Klimaschutzbericht stehen.
Wir halten es für unzureichend, lediglich Klimaschutz innerhalb der festgelegten Systemgrenzen der Universität zu betreiben. Häufig endet das Engagement der Uni am Ende des eigenen Haushaltsplans. Da geht mehr! Wir plädieren für Handlungen oder Einflussnahme auf Entscheidungsträger*innen. Die Uni sollte ihre Verhandlungsposition stärker nutzen und sich auch öffentlich dazu äußern. Besonders hervorzuheben sind hier die Universitätsgebäude, die sich durch das Mieter-Vermieter-Modell oft nicht mehr in universitärer Hand befinden und deshalb nicht im Klimaschutzbericht erfasst sind.
Fazit
Ist der Klimaschutzbericht also ein Reinfall? Keineswegs. Endlich macht die Universität wieder ihre Hausaufgaben in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist notwendig und wichtig, nicht nur um intern Klimaschutzmaßnahmen zu priorisieren und Potentiale zu entdecken, sondern auch um nun im nächsten Schritt die lahme Politik endlich davon zu überzeugen, mitzuziehen.
Es ist jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die Universitäten der Stadt auf strukturelle und finanzielle Hilfe aus dem Senat angewiesen sind, um ihre Klimaziele zu erreichen. Forschung, Lehre und Bildung sind die Zukunft dieser Stadt, dazu braucht es nachhaltige und demokratische Universitäten. Die UHH weiß das - sie sollte anfangen, stärker für sich einzutreten.