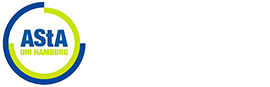Flexibilisieren geht über Studieren // NC-UHH #1Das Entstehen studentischen Bewusstseins im Neoliberalismus
24 March 2021, by Walentin Jähn
„Die Gesellschaft muss nicht reformiert werden, damit es eine bessere Universität gibt. Denn darüber sind wir völlig klar: die Universität ist ein Mittel.“, antwortete Max Horkheimer in einem Dokumentarfilm von 1969 auf die Frage nach der Notwendigkeit einer „besseren“ Universität zur Ausbildung derer, die die Gesellschaft reformieren sollten. Die Studierenden der 68er-Bewegung hatten mit der Reformierung der Gesellschaft ein klares Ziel und wähnten sich im Besitz eines „richtigen“ Bewusstseins ihrer eigenen Rolle: sie wollten es sein, die die Theorie(n) aus den Hörsälen in die Praxis umsetzten und die Gesellschaft liberalisieren. Kleinere Erfolge sind über 50 Jahre nach `68 zu ver- buchen: die Frauenbewegungen, die in den 70er Jahren nach den ersten gesellschaft lichen Liberalisierungen entstand, konnte wichtige Fortschritte zur Befreiung der Frau machen, als abgeschlossen kann jedoch keines der Ziele der `68er betrachtet werden – die Welt ist nach wie vor falsch eingerichtet.
Und so sind es auch die Universitäten. Als in Gesellschaft eingebundenes „Mittel“, reproduziert die Universität deren Ideologien und Sozialcharaktere. Die Universität hat im Kapitalismus ihren Platz als Ausbildungsstätte der Bessersituierten, als Teil kapitalistischer Verwertung ausgefüllt, wie an anderen Stellen in dieser Ausgabe gezeigt wird. Hatten die Studierenden der `68er-Bewegung vermeintlich ein Bewusstsein ihrer selbst1, scheinen die Studierenden von heute gar keinen gesellschaftskritischen Anspruch mehr zu haben. In den Universitäten sind die Studierenden Objekte, Gegenstand kapitalistischer Zurichtung für den Arbeitsmarkt, lediglich Konsument_innen von mundgerecht vorgefertigten Lehrinhalten, die es zu gegebenem Zeitpunkt wieder hochzuwürgen gilt. Die kritische Lehre von Gesellschaft findet an den Hochschulen keinen Platz, daher müssen die Studierenden auch nicht lernen, zu reflektieren. Das Mittel der Wahl ist die Klausur. Das bloße Wiederholen von angelesenen, aufgesogenen, sich gegen jede Lust in den Schädel gezimmerten Inhalten zum vorgegebenen Zeitpunkt, ist symptomatisch für die neoliberale Universität2. Ebenso lässt die Klausur erkennen, wie die Uni ihre Objekte gewaltvoll auf den häufig beschworenen „Ernst des Lebens“ zu- richtet. Auch schon in der Schule schwingt die direkte Konkurrenz unter den Schreibenden mit, Punkte und Noten winken als Medaillen, aber drohen gleichzeitig den anvisierten Notendurchschnitt, welcher einmal über den Rest des Lebens bestimmen wird, zu versauen. Und so tritt das neoliberale Dogma des eigenverantwortlichen Individuums auf: „Du bist deines eigenen Glückes Schmied_in“ heißt eben auch, wenn Du versagst, bist Du selbst schuld. Die Studierenden bekommen in der Klausur nicht bloß erneut die ständige Konkurrenz mit ihren Leidensgenoss_innen vorgeführt, sondern internalisie- ren im besten Falle ganz nebenbei weiterhin ihre Eigenverantwortlichkeit über Bestehen und Nicht-Bestehen.
„Das Ich nimmt den ganzen Menschen als seine Apparatur bewußt in den Dienst. Bei dieser Umorganisation gibt das Ich als Betriebsleiter so viel von sich an das Ich als Betriebsmittel ab, daß es ganz abstrakt, bloßer Bezugspunkt wird: Selbsterhaltung verliert ihr Selbst.“ (Adorno 1951, Minima Moralia 147)
Wie groß der Zwang der Universität, dem die Studierenden sich beugen und jegliche kritische und generell politische Positionierung fahren lassen, zeigt ein Beispiel an der Exzellenzuni Hamburg. Zum Wintersemester wurde Bernd Lucke als Professor für Makroökonomie an die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften berufen. Ein alter Bekannter. Der Uni Hamburg ein alter Bekannter, da er hier noch bis 2014 lehrte, den meisten ein alter Bekannter aus der deutschen Politik. Als ehemaliges CDU-Mitglied gründete der Herr Professor im Jahre 2013 aus Frust über zu liberale Positionen der CDU die Alternative für Deutschland (AfD). Damals galt diese als „Anti-Euro-Partei“, damals schon ein Euphemismus, denn ihre wirtschafts- wie migrationspolitischen Positionen waren auch schon zur Gründung ultrakonservative. Nachdem also diese politische Heimat für Nazis aller Couleur gegründet war und diese mehr und mehr das Sagen in der Partei übernahmen, wurde es Lucke zu viel, er trat aus, gründete seine neue eigene Partei (deren Name, „Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer“, anmutet wie die Coverband einiger Männer in ihrer Midlife Crisis) und ging zurück in die Lehre. Zum Missfallen einiger (weniger) Studierender. Gegen die Antrittsvorlesung Luckes formierte sich Protest, Uni und Presse fantasierten von „undemokratischen“ oder „Nazi-Methoden“, nichts davon war neu. Das Verhalten der Studierenden des Herrn Luckes spricht jedoch Bände über ihr Bewusstsein. Sie verurteilten den Protest ihrer Kommiliton_innen, fühlten sich in ihrer Vorlesung beraubt. Und können wir ihnen das übel nehmen? Ja. Wo dem Mitverantwortlichen für eine der größten Organisationsmöglichkeiten für Nazis seit Gründung der CDU und FDP eine Bühne geboten wird, muss sich Protest formieren. Verstehen wir sie dennoch? Ja, auch das. Denn die Uni diktiert es ihnen. Sie haben ihre Scheine zu machen, ob da vorne nun der Gründer einer Nazi-Partei steht, oder nicht. Auch wenn gerne behauptet würde, die Uni sei kein Platz für Politik, ist sie das natürlich. Das Beispiel Professor Luckes und des fehlenden Bewusstseins seiner Studierenden für die Notwendigkeit der Kritik an seiner Person, macht dies deutlich.
Die Angebote gesellschaftlicher Kritik sind aus dem Großteil der Lehrpläne verschwunden, sind sie doch den engsten Kooperationspartnerinnen der Universitäten, Politik und Wirtschaft, ein Dorn im Auge. Wer dennoch im Studium auf die Kritik gesellschaftlicher Missstände aus ist, findet die Möglichkeit hierzu zumeist nur in der studentischen Selbstverwaltung. „Autonome Seminare“ oder „Gesellschaftskritische Tutorien“, etc., bieten Studierenden die Möglichkeit, eigene Lehrinhalte anzubieten und diese abseits des Curriculums wahrzunehmen. Sie anzubieten und zu besuchen ist wichtig, ohne Frage, bedeutet jedoch Selbstausbeutung und zeitlichen Mehraufwand neben dem meist eh schon anspruchsvollen und zeitintensiven Studium; Creditpoints, den Belohnungen für emsige Studierende, sieht man für sie nicht.
„Allgemein ist das Individuum nicht bloß das biologische Substrat, sondern zugleich die Reflexionsform des gesellschaftlichen Prozess, und sein Bewusstsein von sich als einem an sich Seienden jener Schein, dessen es zur Leistungs- steigerung bedarf, während der Individuierte in der modernen Wirtschaft als bloßer Agent des Wertgesetz fungiert.“ (Adorno 1951, Minima Moralia 147)
Der Anspruch einer Universität, die sich als perfektes Puzzleteil in eine neoliberal-kapitalistische Gesellschaft einfügt, findet sich in der Organisation des Studiums auch neben den Inhalten einer bestimmten Fachrichtung. Nicht selten stellt die Universität, großherzig wie sie ist, Angebote abseits des eigentlichen Studiums - nicht, dass den armen Studierenden noch langweilig wird! Die universitär organisierte Freizeitgestaltung reicht vom Uni-eigenen Fitness-Studio über Sprachkurse bis hin zu Workshops zum richtigen Schreiben, Lesen, Arbeiten und Entspannen. Was für die eine oder den anderen nach dem studentischen Traum von extracurricularen Aktivitäten erscheinen mag, entpuppt sich auf den zweiten Blick schon schnell als Teil neoliberaler Gesellschaft: Nicht nur, dass diese nicht mit dem Studium verwandten Seminare von einigen Universitäten unter dem dümmlich daherkommenden Namen „Schlüsselkompetenzen“ (der Schlüssel wozu? Dem Arbeitsmarkt? Dem perfekten Selbst?) verpflichtend vorausgesetzt werden, sind derlei Seminare das universitäre Äquivalent zu Fortbildun- gen mit dem Zweck der Selbstoptimierung. „Der richtige Umgang mit Prüfungsstress“, häufig angebotener und sicherlich genauso häufig genutzter Workshop, mag hilfreich sein, verschiebt allerdings Verantwortlichkeiten: wer am Druck des immensen Lernpensums zu zerbrechen droht, ist selbst schuld - Hilfe wäre ja da. Diese perfide Verkehrung der Realität — so ist es doch offensichtlich die Universität, welche den Stress und das Leiden der Studierenden verursacht — ist neoliberaler Usus. Wie auch auf dem Arbeitsmarkt verlangt die Universität schon ihren Besucher_innen ständige Flexibilität ab, die wiederum bei den Einzelnen in eine internalisierte Bereitschaft zur Optimierung des Selbst umschlägt. „Be the best version of yourself“, sagt der Neoliberalismus und erwartet von der Uni, wie auch allen anderen Zurichtungsanstalten, neue Arbeitskräfte hervorzubringen. Am Ende der Regelstudienzeit – wehe denen, die sie überschreiten! – stehen, mit dem Soziologen Johannes Gruber gesprochen, „flexible Sozialcharaktere“ für einen „flexiblen Kapitalismus“, optimierungswillige und arbeitswütige Fachkräfte für den Standort Deutschland bereit. Und da haben wir es doch, das neue studentische Bewusstsein.
(1) Ein Blick auf den Werdegang einiger Antiautoritärer der `68-Bewegung, wie Rainer Langhans, Freund verschiedenster Querfrontler_innen und Antisemit_innen, widerlegt erstere Annahme schnell
(2) „Neoliberal“ meint hier mehr als eine bloße Art zu wirtschaften, mehr als die Ökonomie der „Chicago Boys“, Friedrich August von Hayek u.a. Als Reaktion auf die wirtschaftliche Krise der 50er/60er Jahre, setzte sich der Neoliberalismus nicht nur als Ökonomie durch, er wurde zur Ideologie. Diese setzt auf einen Individualismus, der den Einzelnen Verantwortung an Erfolg und Scheitern ihres Lebens und ihnen daher predigt stets sich selbst zu optimieren, um flexibel für Staat und Kapital zur Verfügung zu stehen.
(Bei diesem Abriss kann es sich im Rahmen des Artikels nur um eine verkürzte Definition handeln)