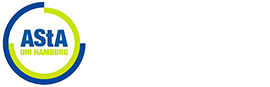Die Universität des Kapitals // NC-UHH #1Über die Frage, wem Universitäten dienen
22 March 2021, by Armin Mandelzweig
I. „Wissenschaft im Dienst des Menschen“?
Sicher, hohe Ideale hegen längst nicht alle Studierenden über die Stätte ihres Studiums. Viele sehen in der Universität vorrangig einen Ort, an dem man sich durch Prüfungen quält, um am Ende – wenn man Glück hat – mehr Geld zu verdienen als der (nicht-studierte) Rest der Gesellschaft. Auf die gesellschaftliche Dimension von Universitäten angesprochen, fällt oft das Argument, dass Forschung eben „wichtig für unsere Wirtschaft“ sei. Ausbildungsstätte für den Arbeitsmarkt und Standortfaktor für die Wirtschaft – so ließe sich dieses Verständnis von Universität ungefähr zusammenfassen.
Doch nicht wenige Studierende grenzen sich davon strikt ab und erblicken in der Universität mehr als eine Hilfestellung für die eigene Karriereplanung: Da an der Universität Wissenschaft betrieben werde und wissenschaftliche Erkenntnisse das menschliche (Zusammen-)Leben verbessern könnten, seien Universitäten Institutionen zum Nutzen der Menschen. Die Universität sei Besseres als bloß eine Ausbildungsstätte für den Arbeitsmarkt – zu einer solchen dürfe die Universität nicht verkommen. Universitäten würden durch Wissenschaft einen wichtigen Beitrag zur Beseitigung vielfältiger Missstände liefern, von Armut über den Klimawandel bis hin zur Beendigung von Wirtschaftskrisen oder sogar bewaffneten Konflikten etc.
Ideale wie diese vertreten nicht nur politisch engagiertere Studierende. Auch die Universität selbst möchte gern so gesehen werden. Von universitärer „Wissenschaft im Dienst des Menschen“ ist etwa im Leitbild der Universität Hamburg die Rede.
Unter vielen linken Studierenden werden solche allgemeinen Vorstellungen von einer Universität, die dem „Wohl der Menschen“ diene (wieder Leitbild der Universität Hamburg), meist noch ergänzt um eine weitere, vermeintlich kapitalismuskritische Diagnose: Universitäten sollten „den Menschen“ dienen, was einschließe, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch zu beleuchten – die Hochschulen könnten das zwar angeblich leisten, würden daran aber aktuell gehindert. Im Neoliberalismus, so lautet diese Vorstellung, würden Universitäten mehr und mehr auf Konkurrenz um Drittmittel1 (seitens der Forschung) und auf Ausbildung für den Arbeitsmarkt (seitens der Lehre) getrimmt. Insgesamt würden Universitäten „unterfinanziert“ und könnten, so die Behauptung, ihrer eigentlichen, gesellschaftskritischen Bestimmung nicht nachkommen. Die „neoliberalen Hochschulreformen“ erscheinen dabei wie ein Programm zur Bekämpfung aller hehren Ideale von einer „emanzipatorischen Wissenschaft“, wie sie doch eigentlich an Universitäten stattzufinden habe.
Was hier häufig unterstellt wird und auch den kapitalismuskritischen Anspruch solcher Positionen ausmachen soll: Die Universität sei ihrem Wesen nach angeblich eine Institution, die im Gegensatz zum Profitstreben der kapitalistischen Wirtschaft stehe. Hier werde ohne egoistisches Motiv uneigennützig geforscht und nachgedacht, befreit vom Zwang, profitabel zu sein. Das Verhältnis von Kapitalismus und Universität wird so als eines des unmittelbaren Gegensatzes bestimmt: Erst der Neoliberalismus trimme die Universität auf Konformität zu den herrschenden, kapitalistischen Verhältnissen. An sich aber, so diese Position, seien universitäre Wissenschaft und kapitalistische Verhältnisse zwei unverträgliche Pole.
Im Folgenden sollen solche und ähnliche Vorstellungen einer Kritik unterzogen werden. Heutige Universitäten dienen vielleicht tatsächlich „der Gesellschaft“, dabei aber der herrschenden, kapitalistischen Gesellschaft und damit auch ihren Profiteur:innen. Ganz sicher dienen sie nicht einfach der Mehrheit der Menschen, die im Kapitalismus ihr Leben fristen. Das zunächst Paradoxe ist, dass Universitäten gerade deshalb Universitäten des Kapitals sind, weil sie vom unmittelbaren Profitstreben befreit sind – etwas, das auch neoliberale Reformen im Kern nicht revidieren. Wieso das so ist, darum soll es im Folgenden gehen, mit einem Fokus auf der Rolle der Natur- und Ingenieurswissenschaften.
II. Kapitalismus und Wissenschaft
Zunächst einmal grundsätzlich: Die kapitalistische Gesellschaft ist, im Gegensatz zu vorhergehenden Gesellschaftsformationen, auf die systematische Erlangung wissenschaftlicher Erkenntnisse angewiesen. Das lässt sich gut im ersten Band des „Kapitals“ von Karl Marx nachvollziehen2 und soll hier kurz angerissen werden.
Wenn im Kapitalismus produziert wird, dann ist das Ziel der Produktion nicht die Befriedigung von Bedürfnissen: Produziert wird von privaten Unternehmen mit dem Ziel, aus Geld mehr Geld zu machen, Bedürfnisbefriedigung ist zur bloßen Bedingung für erfolgreiches Verkaufen degradiert. Dieser maßgebliche Zweck der Geldvermehrung ist grundsätzlich maßlos: Keine Summe Geld ist je genug. Zudem konkurrieren verschiedene Kapitale gegeneinander – wer mehr Profit macht, hat es leichter, die Konkurrenz in der nächsten Runde noch besser auszustechen.
Bei der Schlacht um mehr Profit sind es vor allem zwei Wege, die das Kapital beständig geht: Das direkte Drücken der Löhne der Arbeitenden bzw. das direkte Heraufsetzen der Arbeitszeiten ist der eine Weg. Der andere Weg ist indirekter und hat mit technisch-wissenschaftlichen Innovationen zu tun: Neue Produktionsmethoden werden eingeführt, welche es ermöglichen, dieselbe Menge an Gütern mit weniger Arbeitskräften zu produzieren – sodass die Löhne der frisch in die Arbeitslosigkeit entlassenen Arbeiter:innen eingespart werden können. „Rationalisierung“ wird das zynischerweise genannt3 und demjenigen Kapital, dem dies als erstes gelingt, ist ein Extraprofit gegenüber der Konkurrenz so gut wie sicher.
„Die kapitalistische Produktion entwickelt […] die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses“, wie Marx schrieb – und das ist kein Lob dieser Produktionsweise, wenn man bedenkt, dass diese Entwicklung „zugleich die Springquellen alle[n] Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“ (MEW 23: 536).
Dass die kapitalistische Produktionsweise aus diesem Antrieb heraus ab dem 19. Jahrhundert die Maschinerie und große Industrie erschuf und seitdem beständig weiterentwickelte, erfordert gleich auf zweifache Weise einen funktionierenden Wissenschaftsbetrieb:
1. Zunächst einmal braucht die stetig angestrebte Entwicklung neuer Technologien wissenschaftliche Kenntnisse – sowohl naturwissenschaftliches Grundlagenwissen (Physik, Chemie, Mathematik etc.) wie auch technologisches Spezialwissen (von Maschinenbau bis hin zu moderner Bioverfahrenstechnik). Marx selbst schrieb ganz neidlos, dass die kapitalistische Industrie „die ganz moderne Wissenschaft der Technologie“ erschaffen habe. Sie habe überdies, so Marx, einen eher auf Zufälligkeiten und Gewohnheiten basierenden, vorgefundenen Produktionsprozess verdrängt zugunsten von „bewußt planmäßige[n] und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte[n] Anwendungen der Naturwissenschaft“ (MEW 23: 510). Irgendwo muss im Kapitalismus also eine dementsprechende wissenschaftliche Forschung betrieben werden.
2. Außerdem braucht hochtechnisierte Produktion ein „Personal, das mit der Kontrolle der gesamten Maschinerie und ihrer beständigen Reparatur beschäftigt ist, wie Ingenieure [...]. Es ist eine höhere, teils wissenschaftlich gebildete[...] Arbeiterklasse, außerhalb des Kreises der Fabrikarbeiter“ (MEW 23: 443) notwendig. All die Lebensmittelchemiker:innen, Luft- und Raumfahrtingenieur:innen oder Nanowissenschaftler:innen müssen natürlich irgendwo ihre Ausbildung erfahren.
An einen Wissenschaftsbetrieb und seine Institutionen stellt das Skizzierte natürlich gewisse Anforderungen. Zwei Dinge sind dabei zentral:
1. Klar ist, dass Wissenschaft, die solches leisten soll, organisiert stattfinden muss.4 Über viele Jahrhunderte wurden wissenschaftliche Erkenntnisse meist von vereinzelt arbeitenden Individuen erlangt, mitunter nur durch Glück oder Zufälle. Zielgerichtet arbeitende Forschungseinrichtungen gab es vor dem Kapitalismus nur selten.5 Wissenschaft muss mehr sein als bloßer Zeitvertreib z.B. von einigen Mönchen in Klöstern. Ein Teil des Überschusses der Gesellschaft, des Mehrprodukts, muss für die Unterhaltung einer wissenschaftlichen Institution und die in ihr arbeitenden Individuen aufgewendet werden: Die Einrichtung von Universitäten wird vermehrt notwendig.6
2. Die zweite Anforderung mag zunächst wie ein Paradoxon klingen: Um dem Kapital gut dienen zu können, muss Wissenschaft (weitestgehend) getrennt und selbstständig von kapitalistischen Unternehmen betrieben werden: Wissenschaft darf nicht einfach unmittelbar Profitinteressen unterworfen sein. Die auch von Linken vielfach zitierte (und überdies gesetzlich verankerte) „Freiheit der Wissenschaft“ dient in letzter Instanz dem Kapital. Sie ist kein bloßer Abwehrmechanismus gegen seinen Einfluss, wie häufig angenommen.
Wieso ist das so? Darum soll es im nächsten Abschnitt gehen, der zugleich davon handelt, wieso nur der Staat dafür infrage kommt, den Unternehmen mit der Einrichtung von Universitäten unter die Arme zu greifen.
III. Der Staat des Kapitals und seine Universität
Die meisten Universitäten weltweit werden von Staaten unterhalten. Wieso aber betreiben nicht einfach Unternehmen ihre eigenen Hochschulen?
Einfach deshalb, weil staatliche Universitäten den Unternehmen viel besser dienen. Dass das so ist, ergibt sich aus den beiden bereits angeführten Bedürfnissen des Kapitals nach Wissenschaft: Immer neuen, systematisch erlangten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der einen Seite; einer wissenschaftlich gebildeten Intelligenz, welche in Form von spezialisierten Arbeitskräften zur Verfügung steht, auf der anderen Seite. Beides lässt sich profitabel kaum mit für das Kapital zufriedenstellenden Ergebnissen bewerkstelligen.
Naturwissenschaftliche und technologische Grundlagenforschung, das heißt die Entdeckung neuer Naturgesetze und die Erforschung ihrer praktischen Anwendung, rentiert sich für Unternehmen finanziell einfach nicht. Trotzdem sind Unternehmen auf diese angewiesen. Solche Forschung ist nur potenziell profitfördernd. Und wenn, dann oft erst nach vielen, vielen Jahren – wann genau, das lässt sich schwer abschätzen. Ob beispielsweise der ressourcen- und kostenaufwendige Teilchenbeschleuniger des Hamburger DESY in vielen Jahren neue, winzige Elementarteilchen findet – und ob sich dieses Wissen wiederum – irgendwann – profitabel anwenden lässt; das ist unvorhersehbar.
Die Ausbildung von wissenschaftlich geschultem Personal (Ingenieuren, etc.) wiederum erfordert eine theoretische, wissenschaftliche Ausbildung – die, wenn sie nicht oberflächlich ausfallen soll, einen daran hindert, gleichzeitig schon als rentable Arbeitskraft vollumfänglich für ein Unternehmen zur Verfügung zu stehen. Die Ausbildung einer solchen Arbeitskraft wäre für Unternehmen einzig ein jahrelanger Kostenpunkt, der in dieser Zeit wenig bis nichts einbringt.
Es ist nur folgerichtig, dass der bürgerliche Staat dem Kapital hier zur Seite springt und die wissenschaftlichen Institutionen – Universitäten – schafft und fördert, die das Kapital braucht. Und das nicht bloß, weil er die einzige Institution ist, die dazu infrage kommt. Sondern auch, weil er das will.
Denn der Staat spielt mit Sicherheit eine andere Rolle, als die, welche ihm Sozialdemokrat:innen sämtlicher Couleur zuschreiben: Hier taucht der Staat nur als die Institution auf, die all die schändlichen Verwerfungen eines ungebremsten Profitstrebens zugunsten der Armen und Schwachen zügele und ausgleiche (z.B. durch Sozialgesetzgebung). Etwas, dass der Staat nach dieser Vorstellung viel entschiedener tun sollte.
Dabei geht meist völlig unter, dass der Staat das kapitalistische Profitstreben und Wachstum will: Es ist schlicht die Basis seiner eigenen Grundlagen, auch seiner eigenen Macht. Weniger Wachstum bedeutet weniger Steuereinnahmen; mehr Wachstum bedeuten mehr Steuern, also mehr Handlungsspielraum. Dies ist ein gerade in linken Kreisen viel zu selten beachteter Aspekt moderner Staatlichkeit. Unter anderem aus diesem Grund ist der Staat diejenige Institution, welche dem Kapital diejenigen Bedingungen bereitstellt, welche es nicht selbst profitabel herstellen kann und auf die es trotzdem angewiesen ist (z.B. Infrastruktur, Schulwesen, die Reproduktion der Arbeiterklasse als Ganzes durch Sozialstaat und Gesundheitswesen etc.). Treffend beschrieb Friedrich Engels das einmal so: „[D]er moderne Staat ist [...] die Organisation, welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äußern Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat [...] ist eine wesentlich kapitalistische Maschine“. Engels nannte den bürgerlichen Staat daher auch den „ideellen Gesamtkapitalisten“.7
So ist eben auch die Einrichtung von Universitäten ein Dienst des Staates für das Kapital. Der Staat finanziert die Universitäten, er stellt damit ihre grundlegendste Existenzbedingung sicher. Allein schon so sorgt der Staat dafür, dass die Universitäten, welche ihm ihre gesamte Existenz und Ausstattung verdanken, in seinem Sinne forschen und lehren. Daher hilft es auch nichts, aus linker Perspektive zu behaupten, dass Universitäten doch heiß „umkämpft“ seien – zumindest nicht in dem Sinne, dass in den Universitäten ein Kampf tobe zwischen „emanzipatorischer“ und „kapitalkonformer Wissenschaft“.
Der Staat bzw. die Bildungspolitik will insbesondere auch, dass Universitäten die Unternehmen mit passend ausgebildeten Arbeitskräften versorgen. Hier bessert die Bildungspolitik immer wieder explizit nach.8 Staat, Bildungspolitik oder die Universitätsleitung „versagen“ nicht, wenn sie Universitäten immer wieder an diesem Zweck ausrichten – etwa vor dem Hintergrund, dass es eigentlich um „emanzipatorische“ oder „kritische Wissenschaft“ gehen müsse. Denn Ausbildungsstätte für das Kapital zu sein, das ist nun einmal einer der zentralen Zwecke, für den Staaten Universitäten unterhalten. Genau dasselbe gilt für den Zweck, dass universitäre Forschung kapitalistischen Unternehmen nutzen soll. Auch das stellen Wissenschaftspolitik und Universitätsleitungen seit jeher aktiv und bewusst sicher.9
Ohne hier auf die oft zitierten „neoliberalen Hochschulreformen“ im Detail einzugehen – bei ihnen handelt es sich in der Regel um Nachbesserungen, um Universitäten noch besser auf die Ausbildung für den Arbeitsmarkt und kapitalistisch nützliche Forschung auszurichten. Beides sind jedoch keineswegs Zwecke, die dem Universitätsbetrieb vorher fremd gewesen wären.
Dass Universitäten dem Profitstreben entzogen sind und der Staat die „Freiheit der Wissenschaft“ garantiert, ist somit bloß funktional für das Kapital, welches wissenschaftlich ausgebildeter Arbeitskräfte bedarf und die wissenschaftlichen Resultate der universitären Forschung anwendet. Beides kann also nicht als Beweis dafür genommen werden, dass der Universität als Institution emanzipatorisches Potenzial innewohne. Man kann erst recht nicht Universität und Kapitalismus als Gegensatz auffassen. Der Kapitalismus muss nicht erst durch neoliberalen Reformen in die Universität eindringen. Er bestimmt die Zwecksetzung und auch den Charakter der Universität lange vorher – dazu im folgenden Abschnitt ein wenig mehr.
IV. Über die Macht und Machtlosigkeit der Fakultäten
Über die Natur- und Ingenieurswissenschaften und ihre Notwendigkeit für das Kapital wurde an dieser Stelle ja schon einiges geschrieben. Hier ließe sich folgendes einwenden: Nur weil das Kapital diese universitären Disziplinen braucht, müsste das ja nicht umgekehrt heißen, dass diese Wissenschaft ausschließlich dem Kapital zugute kommt. Könnte sie sich nicht einfach davon freimachen und stattdessen dem Rest der Menschheit – wie zum Beispiel beim Umweltschutz – nutzen?
Um das zu beantworten, muss man sich nur für einen Augenblick vergegenwärtigen, wer denn überhaupt über die Mittel verfügt, naturwissenschaftliche und technologische Forschungsergebnisse praktisch zu nutzen. Und das sind, abgesehen vom Staat (welcher hinsichtlich Militärtechnik und großen Infrastrukturprojekten an solcher Forschung ein Interesse hat), eben nur große kapitalistische Unternehmen. Nur sie können die Geldmassen aufbringen, die es braucht, um aus wissenschaftlichen Entdeckungen ein neues Produkt oder eine neue Produktionstechnik zu machen. Allerdings: Die Produkte, die sie produzieren und die Produktionstechnik, die sie anwenden, wählen sie selbstverständlich danach aus, ob dies für sie profitabel ist. So kommt es dann dazu, dass neueste naturwissenschaftliche Kenntnisse genutzt werden, um Waren im Gebrauch schneller verschleißen zu lassen, als eigentlich nötig (geplante Obsoleszenz) – nur, um möglichst schnell wieder neue Produkte verkaufen zu können. Oder dazu, dass neueste Computertechnik ganze Belegschaften in die Arbeitslosigkeit digitalisiert.
Das hat dann auch Folgen für naturwissenschaftliche und technische Entdeckungen, die gemacht werden und z.B. dem Umweltschutz zugute kommen könnten – wenn sie denn angewendet werden würden. Denn wenn neue Entdeckungen nicht profitabel zu gebrauchen sind, kommen sie gar nicht zur flächendeckenden Anwendung. Z.B. war Energieerzeugung durch Wasserkraft schon im 19. Jahrhundert erforscht und entdeckt, wegen fehlender Rentabilität wurde sie nie flächendeckend angewendet. Ähnliches gilt für umweltschonendere Antriebstechnologien von Pkws oder negative Emissionstechnologien, welche CO2 aus der Luft filtern könnten, allerdings keinem Unternehmen profitabel erscheinen.10 Und auch aus den haufenweise vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen um den menschengemachten Klimawandel ziehen Staat und Kapital nur die Konsequenzen, die sich mit ihrer Geschäftsgrundlage vertragen: Also kaum welche.
Die naturwissenschaftliche Forschung selbst mag (abgesehen etwa von biologistischen Urteilen) weitestgehend von der kapitalistischen Gesellschaftsform unberührte, allgemeingültig richtige Erkenntnisse liefern. Allerdings: Der nahezu alles beherrschende Zweck des Produzierens ist in dieser Gesellschaft die Erzielung von Profit. Dementsprechend können Naturwissenschaft und Technik nur dem Profit dienen, ob sie das nun wollen oder nicht.
Bisher ging es vorrangig um die Natur- und Ingenieurswissenschaften und ihre Dienste für Staat und Kapital. Wie sieht es diesbezüglich bei den anderen Fakultäten aus?
Bei manchen Studienfächern fällt es vermutlich gar nicht schwer, zu sehen, wie diese zielgerichtet für Berufe der kapitalistischen Gesellschaft ausbilden – und anderswo weitestgehend überflüssig wären. Stellvertretend wird hier auf das Studium der Betriebswirtschaftslehre eingegangen.
BWL-Absolvent:innen mögen neben dem Management, wo sie direkt das Interesse des Kapitals gegen die Arbeiter:innen exekutieren, auch im Einkauf oder Vertrieb eines Unternehmens landen, wo sie anderen Unternehmen als Käufer:innen oder Verkäufer:innen gegenübertreten. Etwas das, so Marx, „einen Kampf [bedeutet] worin jede Seite die andre übervorteilen sucht“, letztlich also eine „Arbeit [zur Folge hat], vergrößert durch die beiderseitigen böswilligen Absichten“ (MEW 24: 131-2). Soll heißen: In einer Gesellschaft, in der verschiedene Betriebe nicht um Profit konkurrieren, sondern arbeitsteilig miteinander kooperieren, wäre ein Großteil dieser Arbeit – und dazu zählen Marketing, Kundenbindungsstrategien oder Marktanalysen, wie sie im Studium gelehrt werden – schlicht absurd.
Auch in dieser – für die kapitalistische Produktionsweise tatsächlich unerlässlichen – Fachrichtung stellen Staat und Universität die massenhafte Ausbildung von Arbeitskräften zielstrebig bereit.
Nun ist es kein Geheimnis, dass gerade BWL-Studierende an der Uni manchen als karrieregeile, unreflektierte Anzugträger:innen vorkommen. Was ist mit den Geistes- und Sozialwissenschaften? Einige dieser Studierenden dünken sich allein durch die Wahl solcher Studienfächer alternativ und kritisch; sie blicken deswegen oftmals auf ihre Kommiliton:innen aus der BWL herab.
Dafür besteht allerdings wenig Anlass. Auch die Geistes- und Sozialwissenschaften, wie sie an bürgerlichen Universitäten Forschung und Lehre beherrschen, sind Produkte der kapitalistischen Gesellschaft, ihrer Widersprüche und Ideologien. Und auch sie dienen dieser Gesellschaft, auf ihre ganz eigene Weise.
Wollte man das nachweisen an dem, was in den verschiedenen Fachrichtungen hegemonial gelehrt und gedacht wird (und dann wiederum in den verschiedenen Denkrichtungen in jedem einzelnen Fach), müsste man ganze Bücherregale füllen. Dieser Nachweis soll hier daher anhand einer einzigen Gemeinsamkeit geführt werden, welche diese Fachrichtungen bei all ihren Unterschieden dennoch verbindet: Sie verfolgen in ihrer übergroßen Mehrzahl nicht den Anspruch, wahre Erkenntnisse zu liefern, sondern verfemen diesen Anspruch sogar. Sie relativieren jede geäußerte Erkenntnis als bloße „Meinung“, als subjektiv, als lediglich ein mögliches „Modell“. Wahrheit, also ein Erkennen bestimmter gesellschaftlicher Zusammenhänge, sei eigentlich nicht möglich – es gebe nur unterschiedliche Perspektiven oder Denkschulen, die man so akzeptieren müsse.11 Es passt natürlich zu einer Gesellschaft der nie enden wollenden Konkurrenz, allen Äußerungen über gesellschaftliche Zusammenhänge per se zu unterstellen, sie seien immer bloß subjektiv und ein Erkennen gesellschaftlicher Realitäten daher nicht möglich.
Von Immanuel Kants Erkenntnistheorie über den Skeptizismus bis hin zur radikalen Vertreter:innen postmoderner Philosophie – die Geistes- und Sozialwissenschaften haben ganze Theoriegebäude aufgerichtet, welche versuchen, das philosophisch zu begründen.
Über die Widersprüche, in welche sich diese Versuche stets verstricken, ließe sich viel und lange schreiben: Wie kann man überhaupt als wahr behaupten, dass es keine Wahrheit gäbe? Man behauptet damit einerseits selbst eine Wahrheit (in dem Fall, dass es Wahrheit nicht gibt) und erklärt andererseits, es gäbe Wahrheit gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich.
Hier soll aber auf etwas anderes verwiesen werden: Wer auf einen Wahrheitsanspruch verzichtet, akzeptiert damit die weitestgehende Folgenlosigkeit des eigenen Denkens. Dazu zwei beispielhafte Äußerungen: Erstens: Wer auf eine heiße Herdplatte fasst, verbrennt sich die Hand. Zweitens: Das Kapital vermehrt sich durch Ausbeutung der Arbeitskraft. Wenn das beides nur bloß subjektive Meinungen wären (und niemand käme wohl auf Idee, das über ersteres behaupten), wieso sollte man dann daraus entsprechende praktische Schlussfolgerungen ziehen? Bei beidem ist es äußerst relevant für einen vernünftigen Umgang mit der einen umgebenden Welt, ob der geäußerte Sachverhalt nun wahr ist oder nicht. Sonst spräche im ersten Beispiel eigentlich nichts dagegen, seine Hand auf die heiße Herdplatte zu legen. Eine Aussage, über die man selbst sagt, man könne nicht genau sagen, ob sie wahr sei; sie sei halt nur eine subjektive Meinung oder Perspektive, bleibt praktisch folgenlos.
Andersherum formuliert: Wer die Welt um sich verändern will, Kritik an gesellschaftlichen Zuständen üben will, kommt um einen Anspruch auf Wahrheit nicht herum.
Anstelle einer weiteren Auseinandersetzung, soll hier Hegel stellvertretend etwas ausführlicher zu Wort kommen. Bei ihm findet sich der Zusammenhang zwischen Wahrheitsanspruch des Denkens und dem Stürzen bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse (Staat und Religion bei ihm) auf den Punkt gebracht; außerdem, wie das wiederum zum Anzweifeln der menschlichen Erkenntnisfähigkeit führt, als ein Akt des Unschädlichmachens des Denkens:
„Das Bedürfnis, die Logik in einem tieferen Sinne [...] zu erfassen, ist veranlaßt durch das Interesse der Religion, des Staats [...]. Man hat früher beim Denken nichts Arges gehabt, frisch vom Kopfe weg gedacht. Man dachte über Gott, Natur und Staat und hatte die Überzeugung, nur durch Gedanken komme man dazu, zu erkennen, was die Wahrheit sei, nicht durch die Sinne oder durch ein zufälliges Vorstellen und Meinen. Indem man so fort dachte, ergab es sich aber, daß die höchsten Verhältnisse im Leben dadurch kompromittiert wurden. Durch das Denken war dem Positiven seine Macht genommen. Staatsverfassungen fielen dem Gedanken zum Opfer; die Religion ist vom Gedanken angegriffen, feste religiöse Vorstellungen, die schlechthin als Offenbarungen galten, sind untergraben worden, und der alte Glaube wurde in vielen Gemütern umgestürzt. So stellten sich z.B. die griechischen Philosophen der alten Religion entgegen und vernichteten die Vorstellungen derselben. Daher wurden Philosophen verbannt und getötet […]. So machte sich das Denken in der Wirklichkeit geltend und übte die ungeheuerste Wirksamkeit. Dadurch wurde man aufmerksam auf diese Macht des Denkens, fing an, seine Ansprüche näher zu untersuchen, und wollte gefunden haben, daß es sich zu viel anmaße und nicht zu leisten vermöge, was es unternommen. [Es habe] den Staat und die Religion umgestürzt. Es wurde deshalb eine Rechtfertigung des Denkens über seine Resultate verlangt, [eine] Untersuchung über die Natur des Denkens und seine Berechtigung.“12
Der herrschende Betrieb der Geistes- und Sozialwissenschaften praktiziert bloßes „Vorstellen und Meinen“ offensichtlich lieber als den Versuch zu unternehmen, die Wahrheit über bestimmte Sachverhalte zu ermitteln. Von seiner gesamten theoretischen Fundierung her scheint er also nicht den Anspruch zu verfolgen, dass sein „Denken sich in der Wirklichkeit geltend mache“ und die „ungeheuerste Wirksamkeit“, etwa gegen vorherrschende Verhältnisse, ausübe. Eher scheint diesen Wissenschaften daran gelegen zu sein – „veranlasst durch das Interesse des Staates“ – darauf zu pochen, dass das Denken viel zu anmaßend sei und überhaupt nicht in der Lage sei, wahre Erkenntnisse zu erlangen.
Dass die meisten dieser Fächer jegliche Erkenntnisse immer wieder aufs Neue relativieren, prädestiniert sie nachgerade dafür, falsches und widersprüchliches Bewusstsein, sprich Ideologien, über die Verhältnisse zu (re-)produzieren; die Verhältnisse also zu legitimieren und auch unhaltbarste Zustände als angeblich sinnreich zu begründen.13 Das wiederum ist etwas, das herrschende Instanzen nicht missen mögen, weil es die bestehenden Verhältnisse stützt.
Die Natur- und Ingenieurswissenschaften tragen, wie gezeigt, zur Macht des Kapitals über die Arbeitenden bei, wo sie beispielsweise neueste Technologien entwickeln. Und sie sind da machtlos, wo sie auf etwas stoßen (z.B. die Ursachen des Klimawandels), das für Staat und Kapital nicht nutzbar ist. Die universitären Geistes- und Sozialwissenschaften hingegen richten sich in ihrer selbstverschuldeten Machtlosigkeit von vornherein recht gemütlich ein. Macht kommt ihrem Denken wiederum nur in der Form theoretisch avancierter Ideologien über die bestehenden Verhältnisse zu.
V. Widerstand braucht Wissenschaft, aber niemand braucht die Universität
Noch einmal zurück zum Anfang, zu denjenigen Studierenden, die in Universitäten ganz ohne hohe Ideale nur eine Zwischenstation ihrer Ausbildung für die Berufswelt sehen. Wer diese Ökonomie, ihren Arbeitsmarkt, ihre Konkurrenz und ihr maßloses Wachstum auf Kosten von Arbeitenden und Umwelt einfach hinnimmt und affirmiert, hat sicherlich vieles nicht verstanden. Dass Universitäten in erster Linie Ausbildungsstätten für den Arbeitsmarkt und einen Standortfaktor für die Wirtschaft darstellen, ist hingegen vollkommen zutreffend. Zumindest in diesem Punkt hat, wer das so sieht, ein bisschen mehr verstanden als diejenigen linken Studierenden, die durch und durch idealistisch die Universität und den Kapitalismus zu einem Gegensatz machen, der in Wahrheit nicht existiert.
Eine andere Implikation ist dagegen ja gar nicht falsch: Studierende, die hohen Idealen über die Universität anhängen, verweisen oft darauf, wie wichtig Wissenschaft sei, um die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse zu überwinden. Damit haben sie recht. Ja, Widerstand braucht Wissenschaft.
Wer materielle Armut, aufreibende Arbeitsverhältnisse, den Klimawandel, rassistische Polizeigewalt, sexuelle Übergriffe oder vieles andere überwinden möchte, muss durch theoretische Analyse offenlegen, aus welchen gesellschaftlichen Verhältnissen all diese Dinge erwachsen, durch was sie verursacht sind. Insofern muss linke Politik einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgen: Wissenschaft meint hier nicht das möglichst häufige Zitieren von anerkannten Autoritäten mit akademischen Titeln, sondern die Struktur und die Gesetzmäßigkeiten einer Gesellschaft aufzudecken, in welcher die Subjekte Beschädigungen erfahren. Ja, das mag langwierig oder anstrengend sein14 – auch Karl Marx schimpfte ja über die anstrengende „ökonomische Scheiße“, mit der er sich über so viele Jahre beschäftigte. Aber nur so hat man die Chance, dem Schicksal eines Don Quijote – einem Kampf gegen Windmühlen – zu entkommen und stattdessen die Dinge wirklich an der Wurzel zu packen. Wissenschaft ist also bitter notwendig, wo das Bestehende nicht einfach blind akzeptiert werden soll.
Aus dieser Notwendigkeit von Wissenschaft folgt nun aber keineswegs, Hoffnungen auf diejenigen Institutionen zu richten, die unter den bestehenden Verhältnissen einen wissenschaftlichen Anspruch an sich selbst stellen: Universitäten.
Ihrer Selbstbeweihräucherung, unschuldige „Wissenschaft im Dienst des Menschen“ zu betreiben, sollte man nicht auf den Leim gehen und ständig hilflos daran appellieren. Es handelt sich dabei lediglich um den Heiligenschein, den Universitäten sich selbst verleihen. Was Brecht in „Das Leben des Galilei“ schreibt – das einzige Ziel der Wissenschaft bestehe darin, „die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern“ – das trifft auf heutige Universitäten schlicht und ergreifend nicht zu. Staat und Kapital brauchen Universitäten als Ausbildungsstätten und Forschungseinrichtung für ihre Zwecke. Und sie sorgen permanent dafür, dass Universitäten in diesem, ihrem Sinne funktionieren. Die Wissenschaft, die an den Universitäten betrieben wird, ist dann in erster Linie genau das: Anwendungswissen fürs Kapital, Ausbildung fürs Arbeitsleben im Kapitalismus oder reine Ideologieproduktion.
Damit ist vielleicht nicht völlig ausgeschlossen, dass auch mal jemand, der:die den herrschenden Verhältnissen alles andere als affirmativ oder konstruktiv gesonnen ist, eine Professor:innenstelle ergattert. Sollte so etwas aber überhandnehmen, werden Staat und Kapital jedenfalls ganz schnell dafür sorgen, dass die „Freiheit der Wissenschaft“ wieder auf die Bahnen zurückgeleitet wird, die ihnen dient.15
Enttäuscht kann von all dem nur sein, wer sich von den eigenen Idealen blenden lässt. Studentischer Aktivismus fußt leider viel zu häufig auf einer solchen enttäuschten, idealistischen Vorstellung von Universität. Dementsprechend werden auch praktisch falsche Wege eingeschlagen. Hierzu ein paar Schlussbemerkungen:
Von der Universität als Ganzer sollte man keine Impulse erwarten für eine Wissenschaft, die diesen Namen verdient und das Leben der Mehrheit der Menschen verbessert. Statt also naive Hoffnungen auf kritische universitäre Lehre zu setzen, sollte man eine Kritik der allzu oft affirmativen und ideologischen Lehrinhalte vorantreiben und sich diese gemeinsam mit Kommiliton:innen erarbeiten.
Statt viel Energie zu verschwenden, um gegen eine „Unterfinanzierung“ von Universitäten zu demonstrieren – das heißt im Zweifelsfall für die bessere finanzielle Ausstattung einer im Dienst von Staat und Kapital stehenden Institution16 – sollte man Kritik und Wissenschaft außerhalb des Studienplans selbst organisieren, etwa durch Diskussionsveranstaltungen oder Lesekreise.
Walter Benjamin schrieb einmal, es ginge darum, „eine Gemeinschaft von Erkennenden zu gründen an Stelle der Korporation von Beamteten und Studierten.“17 In der Tat: wer es mit den herrschenden Verhältnissen aufnehmen will, steht vor der Aufgabe, sich und andere wissenschaftlich zu bilden. Niemand, der das vorhat, braucht dafür allerdings die Universität des Kapitals.
Fußnoten:
(1) Finanzmittel, die nicht von der Universität selbst, sondern z.B. von Unternehmen stammen, die an bestimmter Forschung ein Interesse haben.
(2) Im vierten Abschnitt über die sogenannte Produktion des relativen Mehrwerts, vgl. Marx-Engels-Werke (im folgenden MEW), Band 23. Berlin 1972. S. 331-530.
(3) „Rational“ ist daran genau genommen überhaupt nichts: Neue Technik, die den Menschen theoretisch ja Arbeit abnehmen und erleichtern könnte, sorgt im Kapitalismus dafür, dass die einen Menschen weiterhin genauso lange wie zuvor arbeiten und stößt die anderen in die Arbeitslosigkeit, ergo Armut.
(4) Ein organisierter, systematisch arbeitender Wissenschaftsbetrieb wäre natürlich auch jenseits des Kapitalismus, in einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft, die planvoll für die Bedürfnisse der Menschen produziert, sinnvoll. Nur würde ein solcher Wissenschaftsbetrieb dann eben dem gesellschaftlichen Zweck dienen, die Bedürfnisse der Menschen möglichst gut zu befriedigen – und nicht, wie gegenwärtig, in letzter Instanz dem Kapital und seinem Profitzweck.
(5) Die antike griechische Wissenschaft (Mathematik, Philosophie, Astronomie etc.) ist eher als eine von wenigen temporären Ausnahmen anzusehen. Die vor dem Kapitalismus vorherrschenden Produktionsweisen waren nicht auf stetiges Wachstum ausgelegt und zumeist völlig durch Landwirtschaft dominiert, was dazu führte, dass die wissenschaftliche Lehre über lange Zeiträume hinweg völlig unverändert blieb. Dirk J. Strujk: Abriss der Geschichte der Mathematik. Berlin 1965. S. 13. S. 106.
(6) In den letzten 200 Jahren hat sich die Anzahl Universitäten in Europa von ca. 80 auf über 2.200 erhöht. Die Gründungsgeschichte der Universität Hamburg (erst 1919 gegründet) bietet dazu gutes Anschauungsmaterial: Die vorangehenden Debatten für oder gegen die Gründung einer Universität waren lange Zeit ausnahmslos getragen von einer reichen Hamburger Kaufmannsschicht (u.a. Werner von Melle, Edmund Siemers). Sie drehten sich nahezu ausschließlich darum, ob die Kosten einer Universität im richtigen Verhältnis zum erhofften kapitalistischen Nutzen stünden. Als erste Hochschule Hamburgs konnte man sich zunächst nur zur Gründung eines Kolonialinstituts durchringen – welches im Dienste der blutigen Ausbeutung der deutschen Kolonien stand – ehe die Gründung einer Universität 1919 gelang. Vgl. Werner, Michael: Stiftungsstadt und Bürgertum: Hamburgs Stiftungskultur vom Kaiserreich bis in den Nationalsozialimus. Berlin 2015. S. 84-87.
(7) Friedrich Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. MEW Bd. 19. S. 222.
(8) Etwa in den 1960er Jahren mit den von der Studierendenbewegung bekämpf ten „technokratischen Hochschulreformen“ oder mit der Einführung der Bachelor-Master-Studiengänge zur Senkung der Regelstudienzeit in den 2000er Jahren.
(9) In diesen Bereich fällt etwa die seit einiger Zeit zunehmende Praxis der Teilfinanzierung von Forschung durch Drittmittel (vg. Fußnote 1).
(10) Sie profitabel zu machen, um diese Technik stärker zu verbreiten, darin besteht unter den gegenwärtigen Verhältnissen die ganze Forschungsarbeit. Vgl. dazu https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-loesung-fuer-alles/klimaschutz-co2-filter-benzin-85859
(11) Ein paar Beispiele: Dass eh jedes Urteilen immer bloß subjektiv sei, wird schon in der Schule in Fächern wie Geschichte oder Philosophie gelehrt. An Universitäten ist dann z.B. die Rede davon, dass die „Theorie der Geisteswissenschaften herausgearbeitet [habe], wie grade die ganze Tiefe der Subjektivität mit all deren besonderen Kräften in die Deutung [eines zu beurteilenden Gegenstandes] mit eingehen muß“, so der Pädagoge Otto Bollnow. Vgl. Ders.: Die Objektivität der Geisteswissenschaften und die Frage nach dem Wesen der Wahrheit. In: Zeitschrift für philosophische Forschung. 16. Jahrgang. 1962. S. 3-25. Oder es wird ein überzeugtes „Plädoyer gegen den Alleinvertretungsanspruch der wissenschaftlichen Darstellungsformen auf die Verwaltung der wissenschaftlichen Wahrheit“ gehalten. Vgl. Oswald Schwemmer: Wahrheit und Wissenschaft. 2017. Online: https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/forschung/drittmittelprojekte/ernst-cassirer-nachlassedition/lehre Abgerufen 12/2020.
(12) Hegel, Georg W. F.: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I. Frankfurt, 10. Aufl. 2014. S. 71.
(13) Hier wäre für die einzelnen Disziplinen nachzuweisen, wie sie in ihren Themen gebieten die herrschenden Verhältnisse ideologisch stützen: Die Politikwissenschaften den bürgerlichen Staat, die Erziehungswissenschaften das kapitalistische Bildungssystem usw. Beispielhaft sei hier auf den Beitrag „Von der Nutzenmaximierung. Einspruch gegen das Dogma der Wirtschaftswissenschaften“ in dieser Ausgabe verwiesen, der eindrücklich darlegt, inwiefern die universitären Wirtschaftswissenschaften falsches Bewusstsein über die herrschende Ökonomie verbreiten und die kapitalistische Produktionsweise so legitimieren.
(14) Glücklicherweise muss man das Rad nicht auf allen Gebieten neu erfinden: Mit den drei Bänden des Kapitals liegt eine brillante wissenschaftliche Analyse über die kapitalistische Produktionsweise und ihre schädlichen Wirkungen auf die lohnarbeitende Menschheit schon seit über 150 Jahren vor.
(15) Die Berufsverbote der 1970er und 1980er Jahre gegen missliebige linke Universitätsdozent:innen sollten dafür ein Lehrstück sein. Dass es sie nicht mehr gibt, liegt größtenteils daran, dass die politische Linke spätestens seit dem Fall der Sowjetunion deutlich dezimierter ist als zu den damaligen Zeiten.
(16) Zumindest, wer das in dem Sinne tut, dass Universitäten, wenn sie mehr Geld zur Verfügung hätten, angeblich kritische Wissenschaft betreiben würden, begeht genau diesen fatalen Fehler. Studierende oder Universitätsangestellte, welche z.B. für eine bessere Bezahlung als studentische Hilfskräfte oder Mittelbau-Angehörige kämpfen (etwa im Rahmen von TVStud oder der Mittelbau-Initiative), trifft diese Kritik natürlich nicht.
(17) Benjamin, Walter: Das Leben der Studenten. In: Der Neue Merkur 2 (1915). S. 728.