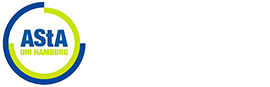Von der Nutzenmaximierung // NC-UHH #1Einspruch gegen das Dogma der Wirtschaftswissenschaften
21 March 2021, by M. Erdhaufen
Auch wenn moderne Wissenschaft sich gerne auf die Position zurückzieht, dass ihre Prämissen nur ein Modell unter vielen seien; auch wenn sich bereits jeder Mittelschüler sofort sicher ist, dass Erkenntnis irgendwie nicht geht, zumindest nicht abschließend; auch wenn es, warum auch immer, ein Wert für sich sein soll, eine Sache aus möglichst vielen Perspektiven zu betrachten:
Ein Urteil über ihren Gegenstand erlaubt sich noch jede geistes- oder gesellschaftswissenschaftliche Disziplin – und sei es eben jenes Urteil der totalen Relativierung jedes Urteilens.
Die Wissenschaften erarbeiten, wie relativiert auch immer, Urteile über ihre Gegenstän- de. Der Artikel prüft ein zentrales Dogma der modernen Wirtschaftswissenschaften: Gegenstand der Kritik ist die Begründung des Prinzips der „Nutzenmaximierung“. Das genießt nämlich weit über die Ökonomie hinaus einen viel zu guten Ruf, weil man mit ihm die Welt so gut anschauen kann.
Der Ausgangspunkt: Das Problem Knappheit
„Unter Wirtschaft wird der rationale Umgang mit knappen Gütern verstanden, die zur Befriedigung menschlichen Bedarfs dienen. Ist der Vorrat an Gütern hinreichend, um den gesamten darauf gerichteten Bedarf stets zu befriedigen, dann handelt es sich um freie Güter. Übersteigt dagegen der Bedarf den Vorrat an Gütern und Dienstleistungen, dann wird von knappen Gütern gesprochen. Nur diese bilden den Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften. [...] Erforschung der Zusammenhänge bei der Verteilung der knappen Güter auf die einzelnen Individuen und Gemeinschaften [...]“ (Gablers Wirtschaftslexikon)1
Während die klassischen Ökonomen den enormen „Reichtum der Nationen“ (Adam Smith) zu erklären suchten, den sie vor Augen hatten, beginnen die modernen Ökonomen ihre Wissenschaft bei einer allgemein menschlichen, niemals überwundenen Not – der Knappheit der Güter, welche zur Befriedigung der sie übersteigenden Bedürf- nisse nie und nimmer ausreichen. Das ist bemerkenswert angesichts dessen, dass ihnen immerhin eine ungeheurere Warensammlung gegenübersteht als ihrem schottischen Gründervater. Schon der erste Satz dieser Wissenschaft bespricht offenbar nicht die Erklärung des vorhandenen Reichtums und seiner Formen, ebenso wenig geht es um die Analyse der ihn begleitenden Armut. Der Anfang der modernen Ökonomie zielt nicht auf die Erklärung der realexistierenden Marktwirtschaft sondern will eine sehr tiefsinnige Frage stellen: Warum wirtschaften Menschen überhaupt und tun nicht gar nichts? Die Römer mit ihren Sklaven, die Feudalen mit ihren Knechten, Unternehmer mit ihren Lohnarbeitern wirtschaften demnach aus demselben Grund und zu demselben Zweck: Sie sind mit dem Problem der Knappheit geschlagen, ihr „Bedarf übersteigt ihren Vorrat“ und sie müssen zusehen, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigen, so gut das im Rahmen allgemeiner Knappheit eben geht.
Einerseits darf und soll man sich von dieser überhistorischen Definition allen Wirtschaftens an den realen Ausgangspunkt von Arbeit und Produktion erinnert fühlen: Die Natur stellt das, was wir brauchen, nicht ohne unser Zutun zur Verfügung; deswegen muss der Mensch die Natur bearbeiten und die Dinge seines Bedarfs erst herstellen. Auf diesem Weg wird Sinnstiftung für die herrschende Wirtschaftsweise betrieben – und diese Sinnstiftung ist schon fertig, noch ehe überhaupt irgendein Moment dieser Ökonomie näher betrachtet wurde: Sie diene, wie jede andere Wirtschaftsweise – auch die Sklavenwirtschaft? – der Bedürfnisbefriedigung. Das eben wäre die Frage, die eine Untersuchung des modernen Wirtschaftens mit Kapital und Arbeit zu beantworten hätte; die VWL aber gewinnt ihr theorie-konstituierendes Axiom jenseits der Analyse ihres Gegenstandes und leitet das positive Vorurteil über ihn aus der Abstraktion „Wirtschaften überhaupt“ ab.
Andererseits wird an die Notwendigkeit der Arbeit, die nützliche Dinge herstellt, sehr verfremdet erinnert, wenn das Problem Knappheit und dessen Lösung nicht Produzieren heißt, sondern „Wirtschaften“, also geschickt mit der Knappheit umgehen. „Der Bedarf übersteigt den Vorrat“, sagt das Wirtschaftslexikon. Ohne Arbeit aber gibt es gar keinen Vorrat – und nach getaner Arbeit, sollte man meinen, sind die Mittel herbeigeschafft, deren Herstellung die Arbeit sich vorgenommen hat. Vor der Produktion von Knappheit zu reden, ist abseitig, hinterher ist es erst recht absurd. Ökonomen aber lassen den nützlichen Arbeitsaufwand, der sein Ziel erreicht, und die zu befriedigenden Bedürfnisse auch als befriedigte nicht gelten. Dagegen setzen sie ihr Dogma der grund- sätzlich unüberwindbaren Diskrepanz zwischen den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung und den Bedürfnissen: „B>G“ (Bedürfnisse größer Güter).
Manche Fachvertreter argumentieren dafür, indem sie sich die Menschen mit ihren Bedürfnissen als wahre Monster der Unersättlichkeit ausmalen. Den Einwand, dass jedes Bedürfnis – Essen, Trinken, Wohnen, Unterhaltung samt der dazu nötigen technischen Hilfsmittel – sein Maß in sich hat, kontern sie damit, dass man sich nach jedem befriedigten Bedürfnis beliebig viele neue einfallen lassen könnte. Unterstellt bleibt dabei der permanente Wille, Kraft und Zeit zur andauernden Bedürfnisbefrieidgung. Alles drei jedoch hat seine eigene Sorte Schranke: Niemand will alles immer wieder neu. Irgendwann ist man müde – und hat deswegen keine Lust und Kraft mehr. Und letztendlich hat ein Tag nur 24h... Andere finden diese Anthropologie des Vielfrasses unglaubwürdig; glaubwürdig dagegen die Feststellung, dass wir unseren Bedarf mit den endlichen Ressourcen dieser Erde decken müssen – also unmöglich decken könnten.
Alle Ökonomen miteinander aber „beweisen“ ihr Dogma von der unüberwindbaren Knappheit, indem sie die Arbeit, das notwendige Mittel zur Beschaffung nützlicher Güter, als einen Minus-Nutzen vom Nutzen der Güter wieder abziehen, sodass das Produzieren wie das Verhungern nutzenmäßig gleichermaßen eine Art Nullsummenspiel ergeben. Am Anfang wie am Ende kommt die Wirtschaft zu keinem anderen Ergebnis als dem: Knappheit. Der Nutzen der Güter, Überwindung der Knappheit, wird durchgestrichen von dem negativen Nutzen der Arbeit, Verbrauch von Ressourcen. Die Wahrheit, dass die Menschen sich entscheiden müssen, ob ihnen die Herstellung einer Sache den Arbeitsaufwand wert ist, drücken Ökonomen so aus, dass der Nutzen des Produkt den Minus-Nutzen der Mühen überwiegen muss, wenn produziert werden soll. Eine „rationale“ „wirtschaftlich motivierte Handlungsweise“ besteht ihnen zufolge darin, einen Größenvergleich zwischen dem Gewinn und dem Verlust an Nutzen durchzuführen.
Von der Nutzenmaximierung
„Die Volkswirtschaftslehre beruht auf der Annahme, dass über knappe Mittel bei alternativ möglichen Verwendungen in zweckmäßiger Weise disponiert werden soll; Überfluss macht Wirtschaften unnötig. Da sich die ökonomische Theorie nur mit wirtschaftlichen Erscheinungen befasst, geht sie von einer ökonomisch motivierten Handlungsweise aus. Sie wird in extremer Vereinfachung als sogenanntes ökonomisches Prinzip formuliert. Es bedeutet: Entweder mit gegebenen Mitteln ein maximal mögliches Resultat oder ein vorgegebenes Resultat mit einem Minimum an Mitteln zu erwirtschaften.“ (Gablers Wirtschaftslexikon, 11. Auflage 1983, Stichwort: Volkswirtschaftstheorie)
Den zweckmäßigen Arbeitsaufwand, der sich durch den Nutzen lohnt, den das Arbeits- produkt stiftet, kennt dieser Mensch, lateinisch vornehm und gelehrt „homo oeconomicus“ genannnt, einfach nicht – nicht das Produkt, sondern das gesteigerte Produkt gilt ihm als sinnvolles Ergebnis seines Wirtschaftens, und das ist ihm nicht einen zweckmäßigen Aufwand, sondern allenfalls einen verringerten Aufwand wert.
Mit seinem homo oeconomicus zeichnet das Fach das Bild eines absurden Menschen, der ausgestattet mit maßlosen Bedürfnissen und einer ebenso maßlosen Faulheit weder dem einen noch dem anderen Drang nachgehen, geschweige denn ihn befriedigen kann, sondern dauernd mit unbefriedigenden Kompromissen zwischen beiden beschäftigt ist. Das nennen Ökonomen den Nutzen maximieren, weil der ohnehin nie ausreichend zustande kommt. Ihr konstruiertes Wesen hat einen grenzenlosen Hunger nach dieser falschen Abstraktion – denn in der Wirklichkeit ist Nutzen immer der konkrete Nutzen nützlicher Dinge, von ihnen will man einmal mehr, ein anderes mal weniger. Die leere Abstraktion „Nutzen überhaupt“ aber will niemand – und schon gleich will niemand ausgerechnet davon immer mehr! Aber das, was die unglückliche Kunstfigur der Ökonomen als Nutzen zu maximieren strebt, ist ohnehin nicht, was man gemeinhin unter diesem Wort versteht: Der Nutzen, den sie maximiert, hat nichts mit dem Gebrauch der hergestellten Güter zu tun, sondern bezeichnet die Differenz von Aufwand und Ertrag bei ihrer Herstellung. Aus der Größe dieser Differenz, nicht aus dem Konsum des Produkts, zieht dieser Dagobert Duck seine Befriedigung.
Die Quelle dieses eigenartigen Menschenbilds ist kein großes Geheimnis: Volkswirtschaftsgelehrte haben sich den Kapitalisten angeschaut und sein Treiben unheimlich vernünftig gefunden. Der freie Unternehmer befriedigt tatsächlich mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit keine konkreten, also auch begrenzten Bedürfnisse, sondern mehrt sein Vermögen. Im Geld, das man bekanntlich nicht essen kann, haben wir das maßlose Bedürfnis, das nie zureichend gestillt ist und für dessen Vermehrung alle Hilfsmittel leider nur endlich sind. Beim kapitalistischen Wirtschaften, wo es nicht um Bedürfnisbefriedigung, sondern um Geldvermehrung geht, wird ein Geldvorschuss getätigt, um einen Geldüberschuss zu erzielen –, und die Differenz von Kosten und Erlösen ist tatsächlich Zweck der ganzen Operation.
Die darin eingeschlossene Unterordnung der Bedürfnisbefriedigung unter dem Vorrang des Gewinns, die Abhängigkeit des ganzen Lebens von der Vorschuss-Überschuss-Rechnung der Kapitaleigner ist ein fundamentaler Einwand gegen die kapitalistische Wirtschaft. Ökonomen dagegen überzeugen sich von der höheren Vernunft derselben, indem sie sich einen Menschen schaffen, der zu ihr passt und nach ihr ruft: Dazu entkleiden sie das kapitalistische Wirtschaftssubjekt seiner – durchs Geld definierten – Ziele und Kalkulationen, sowie seiner Mittel, versetzen den Profitmaximierer in eine Welt der Gebrauchswerte, der Bedürfnisse und der Arbeit. Schon wird nicht mehr der Profit, sondern der Nutzen maximiert; und das Ziel, aus Vermögen immer mehr zu machen, erscheint als ein Gebot der Bedürfnisbefriedigung.
Einen gewissen Preis zahlen die Ökonomen für die Schöpfung ihres Zwitterwesens schon: Nichts stimmt mehr.
Der homo oeconomicus passt weder in die Welt von Bedürfnis und Arbeit noch in die der Geldvermehrung und Rendite. Wer durch zweckmäßige Arbeit die Mittel der Bedürfnisbefriedigung herbeischafft, maximiert nichts; und wer den Profit maximiert, hat weder Bedarf noch Knappheit zum Ausgangspunkt, vielmehr ein Vermögen, das größer werden soll. Aber die Ökonomen bezahlen den Preis gerne: So absurd muss eben die Menschennatur beschaffen sein, aus der sich die freie Marktwirtschaft als der ihr angemessene Lebensraum deduzieren lässt.
Das Grundproblem der Knappheit und das Grundmotiv der Maximierung werden dem Publikum nicht ernsthaft bewiesen; sie sollen, wie alle Grundannahmen über den Menschen, unmittelbar einleuchten, plausibel sein. Tatsächlich wird damit an die Praxis kapitalistischer Wirtschaftsbürger appelliert: Sie haben ihre Erfahrungen mit der Knappheit und wissen, dass sie immer mehr wollen, als sie kriegen.
Die einen, weil sie stets zu wenig verdienen für die Bedürfnisse, die der Kapitalismus mit seinem immerzu wachsenden Warenangebot bei ihnen weckt. Ihre Knappheitserfahrung kommt daher, dass ihr geringes Einkommen es ihnen nicht erlaubt, sich den angebotenen, also vorhandenen Überfluss zugänglich zu machen. Das Ganze kennt nur einen Schluss: Arbeiten gehen für Geld ist ihre einzige sinnvolle ökonomische Tätigkeit, auch wenn sie sicherlich ihre Knappheitserfahrung nie überwinden wird.
Die anderen, denen es an nichts fehlt, weil ihr Erwerb gleich auf Geld und Vermögen gerichtet ist, von dem man eben nie genug haben kann. Ihre ökonomische Praxis ist damit auch unmittelbar gerechtfertigt: Sie betreiben Nutzenmaximierung per se. Die höchste Form des Wirtschaftens überhaupt und jemals!
Ihre sehr unterschiedlichen „Knappheits“-Erfahrungen sollen die Leute sich nicht erklären, sondern als Grundtatbestand ihres Menschseins akzeptieren, um sich damit das Wirtschaften zu erklären, das ihnen die Erfahrung der Knappheit beschert. Ein schöner Zirkel!
In diesem Sinn rekonstruieren die Volkswirtschaftsgelehrten den ganzen Kapitalismus als einen zweckmäßigen Sachzwang, der die Menschen zum rationalen Umgang mit knappen Ressourcen anreizt und zwingt. Ihnen kommt es ganz natürlich vor, dass die Wirtschaft, d.h. der Sektor, in dem Überfluss durch Produktion erzeugt wird, sich durch lauter Instrumente zur Beschränkung der Bedürfnisse und einen effektiven Zwang zur Arbeit zwecks Vermehrung von Kapital auszeichnet.
Das wird dann auch der ganze Nutzen dieser Wissenschaft für diese Gesellschaft sein...
(1) https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wirtschaftswissenschaften-48113