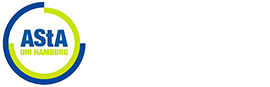Sexismus an der Hochschule und warum er nicht weggeht // NC-UHH #1
20 March 2021, by Leni N.
Wird man an der Uni für eine Frau gehalten, erfährt man Sexismus in verschiedensten Formen. Sei es der Professor, der einem bei der Hausarbeitsbesprechung abschweifend erklärt, dass er es „nicht schlimm findet, wenn Frauen Röcke und Kleider tragen“ und die Sache mit der gleichen Behandlung der Geschlechter sowieso Schwachsinn sei, weil: „Wer will denn schon Pissoirs auf dem Damen-WC?“, oder, wenn einem bei der näheren Betrachtung der Repräsentation verschiedener Wissenschaftler in den Syllabi auffällt, dass sich dort weit mehr Autoren als Autorinnen finden lassen. Immer wieder sehen sich Studentinnen in Situationen, in denen sie mit der Position des ihnen zugeordneten Geschlechts innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Umstände konfrontiert werden. Dass diese sich selten auf angenehme Weise offenbart, darüber sind sich Frauen weitgehend einig – vor allem solche, die sich „emanzipiert“ nennen.
1. Die soziale Rolle der Frau und die Verfügung des Staates über ihren Körper
Das traditionelle Konzept der sozialen Rolle, welche die Frau zu erfüllen habe, einfach weil sie eine Frau ist, wird zwar vielseitig kritisiert und provoziert. Entsprechende Gesetzesentwürfe lassen aber auf sich warten: So wurde die innereheliche Vergewaltigung in der BRD erst im Jahre 1997 zur Straftat erklärt.1 Der Staat mischt sich auch in den Streit um den Körper der Frau, insbesondere ihre Reproduktionsorgane, ein. Etwa indem er das Zeigen bestimmter Körperteile, wie die Brustwarze, immer wieder für strafrechtlich verboten erklärt.2 Oder wenn er in einem Gesetzestext, unter dem Titel „Straftaten gegen das Leben § 218 Schwangerschaftsabbruch“, seinen Besitzanspruch, an dem Unterleib der Frau und alles was in ihm wächst, wie folgt klarmacht: „(1) 1. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.“3 „Insgesamt dauert es von der Befruchtung bis zur abgeschlossenen Einnistung etwa sieben bis acht Tage.“4 Der Staat macht demnach spätestens am 8. Tag nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr sein Verfügungsrecht über den weiblichen Körper geltend. Zwar ist es im Alltag, vor allem bei Akademikern, mittlerweile verpönt Besitzansprüche an den weiblichen Körper zu stellen, doch der Staat selbst tut es bis heute ganz fundamental. Die Frau hat also auch heute noch genügsam sowie konfliktschlichtend, nicht -suchend zu sein. Über haushälterische Fähigkeiten und einen Kinderwunsch sollte sie im besten Falle natürlich auch verfügen. Sie ist Mutter, sie ist Hausfrau. Und beide Berufe übt sie seit jeher ganz pflichtbewusst für die Familie aus. Auf die Fälle, in denen Frauen sich tatsächlich nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen ihrer sozialen Rolle entsprechend verhalten, soll später noch eingegangen werden. Erst wird sich dem traditionellen Fall gewidmet. Dass die traditionelle Vorstellung von Frau-Sein nicht in Führungspositionen oder Lehrstühle von Universitäten passt, allein schon, weil es den Frauen, wegen ihrer Reproduktionsarbeit für die ganze Familie, schlicht an den Kapazitäten für einen zweiten Vollzeitjob fehlt, ist logisch. Wenn schon der Mann abends nach der Lohnarbeit völlig geschafft nach Hause kommt und zu müde ist für sich selbst zu kochen, wie könnte dies dann jemand leisten, die nebenher auch noch Kinder erzieht und einen Haushalt führt. Die Familie in der bestehenden politischen Ökonomie ist kein Zufallsprodukt.5 Sie ist so gewachsen, wie die materiellen Verhältnisse es zuließen. Papa geht für das Kapital arbeiten, Mama bleibt Zuhause, erzieht die Kinder und sorgt dafür, dass Papa morgens dann wieder arbeiten gehen kann – und das nennt sich dann „die wahre Liebe“. Welch glücklicher Nebeneffekt wäre es denn auch, wenn der Arbeiter nach der Ausbeutung im Job ganz zufälligerweise Zuhause nach einem Konzept von Familie lebt, die Erschöpfungsbewältigung und Reproduktionsarbeit privat leistet. Und das auch noch unentgeltlich – Win-Win, zumindest für Staat und Kapital.
Nun versuchen Frauen immer wieder, sich aus der Rolle, die die Gesellschaft für sie vorgesehen hat, zu emanzipieren. An den Hochschulen finden sich vielerlei politische Gruppen und Vereine, einige davon explizit feministisch, andere zumindest implizit. Sexistisches Verhalten, wenn es entdeckt wird, stößt demnach an Hochschulen auf Widerstand; es wird als Problem betrachtet.6
2. Sexismus an der Hochschule
Auch in der Wissenschaft gibt es Sexismus. Beispielsweise bei der „Mutter der Wissenschaften“, der Philosophie. Hier ist der prekäre Gender Gap in der Repräsentation von verschiedenen Wissenschaftlern, beachtlich. Sei es die antike Philosophie, samt Aristoteles, Platon oder Sokrates, oder die modernere Kontinentalphilosophie Nietzsches‘, Hegels‘, Kants‘ u.v.m. – Die „Großen Werke“ stammen allesamt aus männlicher Hand. Philosophinnen wie Simone De Beauvoir oder Hannah Arendt (sofern sie denn vom philosophischen Seminar überhaupt als solche anerkannt werden), sind weitgehend, wenn überhaupt, in gesonderten Seminaren anzutreffen. Das Argument, das nach Konfrontation mit Dozenten bezüglich dieses moralischen Problems aufkommt, ist stets das Gleiche: Man bezöge sich auf die philosophische Geschichte und dessen Große Denker – hier hätten Frauen historisch keine große Rolle gespielt. Und das ist tatsächlich nicht einmal gelogen. Dass es tatsächlich Frauen gegeben hat, die Wesentliches zum wissenschaftlichen Diskurs zu sagen hatten, dafür ist Anna Laetitia Barbauld das Paradebeispiel; eine Dichterin die seit dem 18. Jahrhundert erfolgreich war und im 20. Jahrhundert in Vergessenheit geriet, bis sie im Rahmen der feministischen Literaturtheorie wiederentdeckt wurde. Jedoch ist diese Repräsentation der historischen Unbeliebtheit der Frau als starke, intelligente, autonome Rolle kein Zufall, sondern Ausdruck der Ma- nifestation der sozialen Rolle der Frau als Reproduktionsarbeiterin für den Kapitalismus.
Für das Sexismus-Problem an den Hochschulen gibt es – sowohl von feministischen Studenten als auch von Seiten der Hochschulverwaltung – einige Lösungsvorschläge: Ein kritischer Umgang mit dem „Gender Gap“ und sexistischen Figuren in der Wissenschaftsgeschichte, wenn nicht sogar die Verbannung dieser, wird gefordert. Unter anderem im Fachbereich Geschichte wird es einem außerdem zum Verhängnis, wenn man in seinen Studien- oder Prüfungsleistungen das Gendersternchen vergisst. Im Namen der „Stabstelle Gleichstellung“ der Universität Hamburg wird jedes Semester eine Philosophiestudentin zur Gewinnerin des Preises für die beste Hausarbeit gekürt, ganze 75 Euro kann Frau hier absahnen.7 Die Problematik, die sich solchen Lösungsvorschlägen offenbart, ist zum einen die, dass die Universitäten des Kapitalismus, wie in anderen Artikeln dieser Zeitschrift bereits weitergehend analysiert wurde, keine Einrichtungen im Interesse von „Lehre, Bildung, Forschung“ im Namen des Menschen darstellen, sondern Ausbildungsstätte und Wissenschaftsorgan von Staat und Kapital. Die Forschung, die tatsächlich nicht direkt im Dienste des Profits steht (also nicht entweder von einer Firma selbst in Auftrag gegeben, oder aber in dem Interesse verfolgt wird, irgendwann daraus Profit zu schlagen) befindet sich im ständigen Kampf um finanzielle Mittel.
3. Frauenkampf ist Klassenkampf
Die Befreiung der Frau vom Zwang ihrer sozialen Rolle ist nicht mit dem Interesse des Kapitals zu vereinbaren. Und wenn es doch mal eine freche Frau schafft, aus der Bahn zu tanzen, dann doch immer nur in dem Rahmen, in dem sich der Ausbruch verkaufen lässt. Demnach gibt es sogenannte Karriere-Muttis oder auch kinderlose Businessfrauen, welche „die Glasdecke durchbrochen haben“ und sich selbst emanzipiert und glücklich schimpfen. Das traditionelle Bild der Frau haben sie abgelegt und sich von den Männern unabhängig gemacht. Sie sind meistens keine Hausfrauen, oder stellen sogar selbst (meist migrantische) Frauen als Haushaltshilfen ein, und haben es im Berufsleben „zu etwas gebracht“ – ob nun mit oder ohne Kind. Das unentgeltliche soziale „Anstellungsverhältnis“ der Frau in der Familie, in Form von Putzen, Kochen, Erziehen und dem generellen Reproduzieren, ist einem bezahlten Verhältnis gewichen oder hat sich dem hinzugefügt. Zum Problem wird dies erst, wenn der Staat merkt, dass ihm die Bevölkerungsreproduktion zu sehr abflacht, da Frauen aufgrund ihrer Jobs ihrer primären Aufgabe in der Geburtsmaschinerie nicht nachgehen können. Bis das nicht geschieht, oder der Konservativismus nicht seine Wege findet die Frau wieder in die Rolle der Mutter zu zwängen, ist dies dem Staat nur recht. Für ihn bedeutet dies: Eine Arbeitskraft mehr. Dass diese Emanzipation der Frau aus der Rolle der Reproduktionsgehilfin in die Rolle der Arbeitskraft also kein Fortschritt in Bezug auf die Abschaffung der Ursachen von Sexismus sind, muss klar sein. Sie ist lediglich das Brechen mit ihrer sozialen Rolle im Formalen, im Anstellungsverhältnis. Doch wird einem auch jede Businesswoman bestätigen können, dass Businessmen in der Regel nicht die emanzipiertesten Geister sind und den erfolgreichen Frauen der Sexismus also auch nicht im Bürosessel erspart bleibt. Was die moderne Frau geschafft hat ist aber, sich zumindest in einem ähnlichen Sinne dem Kapital als Produktivkraft anzubieten, wie es vorher bloß Männern vorbehalten war. Der soziale Kampf, den Frauen seit Jahrhunderten gegen das Patriarchat führen, ist unerbittlich. Eine gesetzliche Tür eröffnet zu haben, sich potenziell auch ohne einen Ehemann eine Existenz im Kapitalismus aufzubauen zu können, bedeutet für viele Frauen erstmals den Zugang zu Bildung. Arbeitskräfte müssen schließlich geschult werden. Dieser bescheidene Handlungsspielraum ist es jedoch, der vielen Frauen ermöglicht, sich erstmals auch politisch zu bilden und zu organisieren, gegen den Staat, das Patriarchat und das Kapital. Was aber niemals außer Acht gelassen werden darf ist, dass auch der Kampf der Frau im Kapitalismus ein proletarischer Kampf ist. Demnach kann mit den Verhältnissen, welche sie als Frau knechten, nur gebrochen werden, wenn der Klassengegensatz aufgehoben ist. Erst wenn der kapitalistische Staat und seine bürgerlichen Ideologien abgeschafft sind, kann man sich der großen Aufgabe widmen, dem Sexismus den Garaus zu machen. Bis das jedoch nicht geschehen ist, wird der Kampf gegen den Sexismus stets bloß ein Trommeln auf Pauken sein. Eine falsche Empörung über das angebliche Vergehen an einem moralischen Kodex. Doch gibt es so einen Kodex nicht. Was es aber gibt ist das, was sich uns offenbart: Menschen verhalten sich sexistisch. Der Sexismus ist demnach kein „Fehler im System“, kein Ausrutscher von Sexisten, er ist ganz einfach systemimmanent. Er ist im Gesamtpaket enthalten. Die materiellen Verhältnisse des Kapitalismus haben den Sexismus, in der Form, in der er heute vorzufinden ist, her- vorgerufen und nur seine Abschaffung kann ihm die Grundlage nehmen.
(1) „Das Gesetz, das Vergewaltigungen in der Ehe zur Straftat machte, trat erst am 1. Juli 1997 in Kraft, vor nun 20 Jahren; im Bundestag angenommen mit 470 zu 138 Stimmen bei 35 Enthaltungen.“, https://www.sueddeutsche.de/ leben/sexuelle-selbstbestimmung-als-vergewaltigung-in-der-ehe-noch-straf- frei-war-1.3572377
(2) https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/-freethenipples-die-angst-vor-der-brustwarze-3156430.html
(3) https://www.buzer.de/s1.htm?g=StGB&a=218-219b
(4) https://medela-family.de/schwangerschaft/kinderwunsch/einnistung/
(5) So analysierte bereits Engels 1884, dass „je weiter die Zivilisation fortschreitet, je mehr ist sie genötigt, die von ihr mit Notwendigkeit geschaffenen Übelstände mit dem Mantel der Liebe zu bedecken“. Demnach ist die Familie kein natür- liches Phänomen, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt: das Einrichten der Proletarier in den Umständen des Ausgebeutetwerdens durch die Kapitalisten. Friedrich Engels – „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ in: Karl Marx/Friedrich Engels – Werke, Band 21, S. 172.
(6) https://www.zeit.de/campus/2018/02/universitaeten-probleme-ungleichheit-diskriminierung-erfahrungen/seite-4?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
(7) https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/gleichstellung/datenbank/personal/swip-hausarbeitenpreis.html