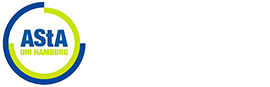Integration oder Revolution // NC-UHH #1Studentinnen und die Frage nach der gesellschaftlichen Emanzipation
14 March 2021, by Anna Noemvri
Während der viel-gerühmten und stark verkitschten Studierendenbewegung 1968 forderten sie das System heraus. Die Studierenden rebellierten auf der Straße und gruben vergessene marxistische Theorien aus. Doch aus dem vermeintlich revolutionären Subjekt wurden später Ministerinnen und bürgerliche Systemstützen. Ist die Universität denn nun ein Hort der Revolution oder produziert sie zuverlässige Systemanhängerinnen? Leider sind nicht alle Antworten so unkompliziert und sexy, dass sie in ein kommunistisches Manifest passen.
Die Revolte der Studierenden war kein neues Phänomen in den sechziger Jahren. Immer wieder protestierten an modernen Universitäten Studierende gegen ihre Bedingungen an der Universität. Sie sahen in den Universitäten einen fehlerhaften Betrieb und hielten dem ein besseres, idealisiertes Bild entgegen.1 Bessere Bedingungen für ein Studium würden angeblich zu mehr Erkenntnis und schließlich dann auch zu einer besseren Gesellschaft führen. So lang die Geschichte der studentischen Kämpfe auch zurückreicht, nie kamen sie so in eine Position der Systemgefährdung. Das ist auch nicht verwunderlich, waren die Kämpfe doch hauptsächlich „primitiv-akademische“ Kämpfe, das heißt sie drehten sich allein um die universitäre Institution und ihre Reformen – weswegen sie auch in bürgerlichen Kreisen wunderbar anschlussfähig waren (deren Mitglieder ja meistens auch selbst studiert hatten und denen die Forderungen gar nicht so neu waren). In den Kämpfen wurde ja kaum hinterfragt, welche Rolle die Universität in der Gesellschaft spielte. Das trifft auch auf die Revolten um 1968 zu. Auch wenn es Ausnahmen gab, in ihrer Mehrzahl sprachen die Aktivistinnen aller Länder von einer idealen Hochschule, in der Kritik und Erkenntnis nun diesmal wirklich gelehrt werden sollten. Dennoch bleibt der studentische Protest ein Ort der Agitation. Denn verbunden mit proletarischen Massenbewegungen kann aus ihm ein transformatives Moment entstehen.
Die Negation der Verhältnisse ist gerechtfertigt!
Auch Veränderungen außerhalb des akademischen Bereichs sind im Interesse der Studentinnen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse so sehr verändert, dass die Rolle der Akademikerin nicht unberührt blieb. Durch die massive Technologisierung der Produktionsverhältnisse war das Studieren kein Garant mehr für eine mindestens kleinbürgerliche Stellung, sondern nun wurde das Studium auch für geringer entlohnte Lohnarbeit zur Notwendigkeit. Im postfordistischen Kapitalismus steigerte sich der Bedarf nach qualifizierten Arbeitskräften und eröffnete damit eine längere Ausbildung für seine Lohnarbeiterinnen. Die Eröffnung der Massenuniversitäten führte zu einer Abwertung der Abschlüsse, aus der unter anderem eine – bis heute anhaltende – Proletarisierung vieler Akademikerinnen folgte.
Auch wenn Studentinnen als (zukünftige) Lohnarbeiterinnen immer wieder die Verhältnisse reproduzieren, die sie in ihre ökonomische Lage drängen, behalten sie doch eine Sonderstellung an der Universität. Als angehende Wissenschaftlerinnen wird von ihnen erwartet, die Gesellschaft analysieren und manchmal sogar kritisieren zu können. Ihnen werden also für ihre Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt Zeit und Ressourcen in einem begrenzten Rahmen eingeräumt, um sich mit den Verhältnissen und der Kritik daran auseinanderzusetzen. An der Universität können Studentinnen also einen Raum finden, in welchem ihnen zeitliche und finanzielle Ressourcen zu Verfügung stehen, auch um sich mit Gesellschaftskritik und Theorie intensiver auseinander setzen zu können. Die historisch entwickelte relative Autonomie der universitären Strukturen eröffnet ihnen so auch Möglichkeiten. In der Institution Universität, die schon lange den historischen Anspruch hat sich selbst zu verwalten in strukturellem Aufbau, Titelverleihung und personeller Besetzung, war es fast schon selbstverständlich, dass sich Studierende ebenfalls organisierten und repräsentative Stellen einnahmen – wenn auch nie mit einem Recht auf Mitentscheidung. Diese Selbstverwaltung eröffnete Möglichkeiten zur Erkämpfung von Freiräumen und linker Politisierung von ASten oder Fachschaftsräten. Hier konnten sich Studierende treffen und organisieren. Vor allem seit den 60ern Jahren konnten sich linke Gruppen so Öffentlichkeit für Kritik, Agitation und Selbststudium sichern. Vor diesem Hintergrund können sich auch heutige Studierende, ihre wenig rosige Zukunft als Lohnarbeiterinnen vor Augen, mit den systematischen Widersprüchen konfrontieren und emanzipatorische, anti-systemische Gedanken entwickeln.
Die Studentin hat alles zu verlieren
Die Chance zur Radikalisierung, welche die universitäre Ausbildung bringen könnte, wird jedoch immer wieder ausgeglichen durch mehrfache Re-Integrationsmechanismen in die verstockte Gesellschaft. Die Studierenden werden durch verschiedene Ebenen an ihre bürgerliche Unterwerfung gebunden: auf ideologische, kulturelle und materielle Weise wird ihnen der Friedensschluss mit den Verhältnissen nahegelegt. Diese geistige Umarmung der Verhältnisse ist für den Kapitalismus wichtig, weil die Studentinnen durch ihre kulturellen und technischen Leistungen das System ideologisch stützen sollen und die Profitgenerierung schneller und effizienter gestalten können.
So wird der Studentin vorgegaukelt, mit dem Abschluss ein Recht auf eine besondere gesellschaftliche Stellung zu haben. Sie sei Teil einer Elite, wird ihr gesagt, sie sei etwas Besseres. Der ideologische Komfort übertüncht Ängste um die eigene ökonomische Existenz. Aber tatsächlich hatte einst, vor dem Technologisierungsschub in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der universitäre Abschluss eine beträchtliche Bedeutung. Weil noch weniger Menschen als heute studieren durften, wurde ihm einiges zugemessen. Die trauernde Erinnerung an die einstige gesellschaftliche Relevanz der wissenschaftlichen Stellung vor ihrer Proletarisierung lässt die Studentin an einer konservativen Systemkonformität hängen. Diese Glorifizierung des gesellschaftlichen Beitrags von Geisteswissenschaften tritt auch bei vermeintlich linken Studierenden auf, die die Uni der reinen Profitorientierung entziehen wollen. Dabei verkennen sie den historischen Zweck der Universität im kapitalistischen System; und wie der studentische Aktivist Hans-Jürgen Krahl Ende der 60er Jahre ausführte, sind Enteignungsangst und Geschichtslosigkeit eben doch Elemente des Kleinbürgertums.
Die soziale Herkunft (der Gang zur Uni bleibt eben doch häufig eine Frage des Geldbeutels der Eltern) und das Milieu binden die Studentin vielfach an kleinbürgerliche Ideologien – machen sie zu einer loyalen Stütze des Systems. Die Studentin existiert dabei nicht nur im Verhältnis zur kapitalistischen Gesellschaft, sondern auch im Verhältnis zur institutionalisierten Wissenschaft, der Universität. Hier Objektivität zugeschrieben zu bekommen, heißt nicht, so nah wie möglich an verifizierbare Fakten zu gelangen, sondern sich der vorgeschriebenen Form zu unterwerfen, wie der US-amerikanische Philosoph William James ausführt. Er kritisierte bereits 1903, dass Wissenschaft sich immer weniger um die inhaltliche Auseinandersetzung drehe, sondern Gelehrsamkeit vielmehr nur durch Form und Stil ausgedrückt werden. Wissenschaftlich ist damit nicht der Inhalt der Arbeit, sondern ihre Aufmachung und der akademische Hintergrund der Autorin und ihrer Institution. Diejenigen, die sich an den Grenzen der Formvorgabe bewegen oder als „zu parteiisch“ deklariert werden, verlieren ihren Anspruch in der wissenschaftlichen Debatte respektiert zu werden (davon gibt es wenige Ausnahmen, wie Klaus Theweleits Männerphantasien2). Die akademische Freiheit der Universität heißt eben nicht, dass alle Ansichten berechtigt sind, sondern sie bedeutet auch, auszuschließen und zu zensieren. Infolge dessen hat sich die Studentin anzupassen und der herrschenden Form der Wissensproduktion zu unterwerfen oder sie wird aus der Universität gedrängt. Prüfungen sind eine Form der Aussortierung, nur wer am Ende bitte nicht zu sehr kritisiert, hat vielleicht Glück auf einen guten Abschluss und dann vielleicht Glück auf einen guten Job.
Genau das ist eines der schlagenden Argumente: Die Studentin wird mit ihrem alten Ruf gelockt und mit der Möglichkeit aufzusteigen. Das Studium eröffnet ihr eine Chance (nicht Garantie!) auf Karriere. Eine Chance, die durch linken Aktivismus ruiniert wird, wenn sie etwas Beständigeres ist als eine kurze Lifestyle-Phase.
Die Sortierung, die Karrieremöglichkeiten, die Eingliederung in die Gesellschaft –das sind nicht nur Dinge, die den armen Studierenden einfach so passieren, vielmehr ist das ein Prozess im Studium, an dem sie bereitwillig teilnehmen – und das auch trotz der Verschlechterung ihrer Lage. Als Herbert Marcuse das Verhältnis der US-amerikanischen Bevölkerung zu ihrem Gesellschaftssystem Anfang der 60er Jahre betrachtete, fiel ihm auf, dass die amerikanischen Arbeiter:innen mit zunehmenden Schwierigkeiten und Widersprüchen konfrontiert waren. Die US-Amerikanerinnen nahmen das jedoch nicht zum Anlass, sich zu radikalisieren, sondern banden sich noch enger an die Regierung. Ähnlich handeln auch jetzt die Studentinnen: die Situation wird schwieriger auszuhandeln, aber statt Kritik zu entwickeln, binden sie sich an die kulturelle, materielle und ideologische Integration, um sich selbst vor Verlust und Chaos zu bewahren. Frei nach Marcuse werden „Indoktrination, Manipulation und das Management der Psyche […] auch zu Ausdrucksmechanismen der Wünsche und Interessen“ der ideologisierten Studierenden.
Exit Bürgertum: Kritik ihrer Wissenschaft
Die Studentin findet sich also in einer widersprüchlichen Lage. Zum einen erfährt sie durch ihre eigene Proletarisierung den klassischen Widerspruch der Lohnarbeiterin: sie reproduziert die ökonomischen Verhältnisse, die sie ausbeuten. Andererseits werden explizit Methoden zur Analyse und Kritik in ihre Ausbildung eingebettet. Zukünftige Akademiker:innen müssen nicht einmal Teil der bürgerlichen Klasse sein, durch ihr technologisches oder kulturelles Wissen helfen sie dennoch als Lohnarbeiter:innen, die herrschenden Verhältnisse zu zementieren. Als Intellektuelle wird es der Studentin erleichtert, das System theoretisch zu erfassen und die Notwendigkeit seiner Abschaffung zu erkennen – und dennoch soll sie helfen, dieses System noch etwas länger schleppend aufrechtzuerhalten.
Aber dieser Widerspruch zwischen systemstützender Arbeitskraft und Befähigung zur umfassenden Kritik sollte nicht überhöht werden, kommt doch nur ein Bruchteil aller Studierenden überhaupt in den Kontakt mit einer radikalen Gesellschaftskritik.
Marcuse beschreibt zwei Tendenzen in der kapitalistischen Gesellschaft: einerseits die Tendenz, aus den Verhältnissen heraus ihre Abschaffung zu entwickeln; andererseits die im Moment überwiegende Tendenz, dass das System so stabil ist, jede wirkliche Änderung unterbinden zu können. Das Wissen um Transformation wird soweit zurückgedrängt, dass es die Studentin kaum noch erreicht. Die oben beschriebene Integration in die Verhältnisse läuft so reibungslos und effektiv, dass die Studentin nicht einmal aus der Radikalität zurückgeholt werden muss. Es ist ihr ein selbstverständliches Bedürfnis im heimatlichen Hort der Unterwerfung zu verbleiben, die Frage nach radikaler Systemkritik stellt sich den meisten nicht einmal.
Wie erläutert ist der Zweck der universitären Wissenschaft die Profitmehrung und ideologische Stabilisierung. Denn die Institution Universität hat keine neutrale Rolle im gesellschaftlichen Gefüge, sondern bleibt ein Instrument der Klassenherrschaft. Die Wissenschaft dient den objektiven Bedürfnissen der bürgerlichen Gesellschaft (was die Erkenntnisse nicht unbedingt falsch macht, aber jegliche Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit wirklichen gesellschaftlichen Alternativen ausschließt). Die Studentin reproduziert die bürgerliche Ideologie und ihre Herrschaft, ohne Teil daran haben zu können. Die Bedingungen der transzendierenden Kritik werden ausgeschaltet.
Der Weg der Studentin aus dieser trostlosen Perspektive führt über die Ablehnung der bürgerlichen Wissenschaft und der Reflexion über die Rolle, die sie in der Gesellschaft spielt. So verabschiedet die Studentin sich von den „Aufstiegsmöglichkeiten“, die ihr versprochen werden. Denn kein Master of Arts wird sie von dem ökonomischen Elend erlösen können. Sie verabschiedet sich auch von der Vorstellung einer elitären geistigen Arbeit, die sie besserstelle als andere Lohnarbeiterinnen. Denn, wie Krahl einst erläuterte, „die Vernichtung des traditionellen Kulturbewusstseins [eröffnet] überhaupt erst die Möglichkeit proletarischer Reflexionsprozesse.“
Dabei bleibt die Studentin eine seltsame Figur der kleinbürgerlichen Proletarierin, aber als revolutionäres Subjekt sollte man keine Hoffnungen in sie setzen. Zugleich sollte man ihnen revolutionäres Potenzial auch nicht völlig absprechen. Was letztlich zählt, ist die Verweigerung der Affirmation bürgerlicher Wissenschaft, ohne sich jedoch zu erlauben dabei in Antiintellektualismus zu verfallen. Was Lenin 1908 ausführte, dass die Radikalität der Studierenden begrüßenswert ist, gilt heute immer noch. Bei der bloßen Existenz von Radikalität darf man nur nie stehen bleiben. Es zählt ihre Organisation und ihre ernsthafte, tiefgreifende Auseinandersetzung mit radikaler Gesellschaftskritik. Erst dann führt ihr gemeinsamer Kampf mit einer proletarischen Massenbewegung zum Umsturz.
Fußnoten:
(1) Wieso das ideologischer Unsinn ist, wird in dem Artikel "Die Universität des Kapitals. Über die Frage wem Universitäten dienen" besprochen.
(2) Theweleits ungewöhnliche Doktorarbeit "Männerphantasien" wird von einem essayistischen Sprachstil durchzogen. Zudem wird häufig unkommentiert auf popkulturelle Referenzen zurückgegriffen, um seine Punkt zu unterstreichen. So steht plötzlich Spiderman neben einer nationalsozialistischen Zeichnung eines Diskuswerfers - die Intention ist klar: der männliche Körperkult, der faschisiert werden kann, besteht auch außerhalb des Nationalsozialismus, im Text wird das aber nicht weiter ausgeführt.